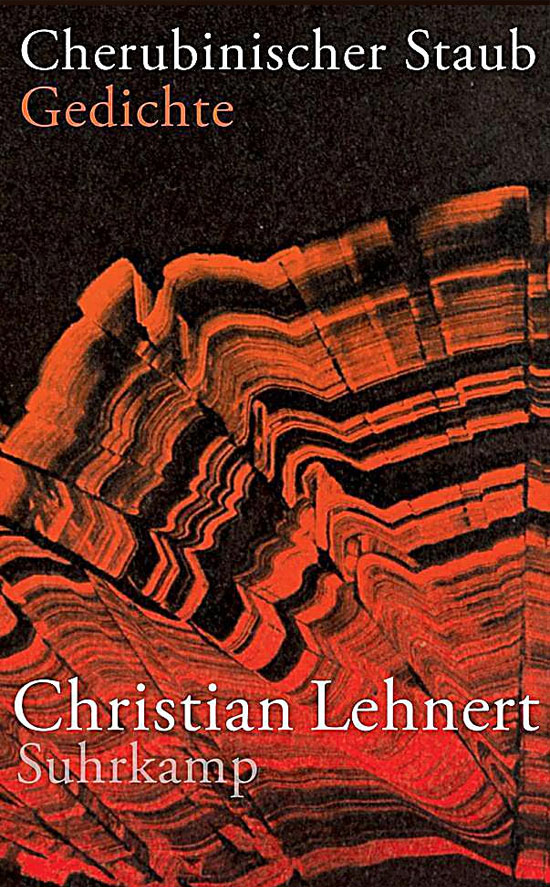
Bestellen
auf Buch7.de - sozialer Buchhandel
Christian Lehnert: Cherubinischer Staub
Es ist der siebte Gedichtband des gebürtigen Dresdeners Christian Lehnert, der schon im Titel „Cherubinischer Staub“ die himmlische Dimension zu erkennen gibt, in die seine metrisch und in Reimen gebundenen Gedichte hineinreichen. Neben den Seraphinen gehören die mit ihnen oft in einem Atemzug besungenen Cherubine wohl zu den bekanntesten Engelsgattungen. Heute werden sie allesamt kaum noch ernst genommen, und doch ist in Erinnerung: Unmittelbar nach der Vertreibung des Menschen aus dem Garten von Eden werden in Genesis 3,24 die Cherubine damit beauftragt, den Baum des Lebens vor dem Menschen zu schützen; ihm soll nach seinem Diebstahl vom Baum der Erkenntnis nicht auch noch ein ewiges Leben überlassen werden.
In einem Moment noch weitgehend ungeregelten intensiven Fortschritts durch synthetische Biologie und künstliche Intelligenz wirft die Verbindung des Adjektivs „cherubinisch“ mit dem auf Vergänglichkeit deutenden „Staub“ die bange Frage auf, ob sich die Lyrik nun zu einem Abgesang auf jene „Schutzmächte“ bereitfindet, die den Menschen vor den letzten Auswüchsen seiner Hybris bewahren sollten. Bei Lehnert aber erleben die Engel eine überraschende Renaissance, die sie gleichwohl aller naiven Implikationen entkleidet. Der Staub, der im Gedicht „Morgengebet“ als „Pollenstaub“ wiederkehrt, wird durch aufsteigende Luft und Wildbienen bewegt, ist zugleich ätherisch und gegenständlich und nichts von beidem wirklich. Nicht als Ablagerung, sondern als flirrende, in der Sonne tanzende Partikel oder gar Blütenelement öffnet das Nomen „Staub“ dem Leser die Tür zu einem lyrischen Kosmos, der durch Schönheit zur Besinnung bringen will – und trägt doch stets die Ambivalenz eines möglichen Endes in sich.
In den Epigrammen der ersten zehn Seiten heißt es unter der Überschrift „Engelsgeräusch“ in Antwort auf einen Tropus der Osternacht: „Wen sucht Ihr hier im Grab? Den Wind und Echoklang, / den Zungenlaut am Grat zum warmen Höhlengang.“ Die Geräusche der Engel, hier hörbar als „Wind“, „Echoklang“ und „Zungenlaut“, treten gewissermaßen zwischen die Frauen am Grabe Jesu und den Fragesteller und vermitteln zwischen dem Inneren und Äußeren der Grabeshöhle, zwischen Tod und Leben, Kälte und Wärme und – wie ein Atemzug – zwischen Frage und Antwort. Der Frage nach dem, was die Frauen suchen, folgt noch im selben Hexameter (und dessen Rhythmus wie ein Ausatmen zu Ende führend) „Den Wind und Echoklang“ – wie ein Hauchen noch vor einer definitiven Antwort. Ungreifbar und unbegreifbar ist das „Wehen“, das die allzu unmittelbare Stimme Gottes verhüllt (so bei R. M. Rilke), unbegreifbar dieses „dazwischen“; ungreifbar ist auch der „Grat“ in Alliteration zum „Grab“ – und bildet, so könnte die Pointe dieses Klangspieles lauten, dessen Alternative. Der schmale Grat erscheint als jener Punkt oder Moment der noch unentschiedenen Möglichkeiten des noch nicht fest gefügten, toten und damit als Gegenbild des Grabes.
Die Engel sind heute „unsichtbare Nervengeflechte“ und „Resonanzkörper“ – so Lehnert 2017 in „Der Gott in einer Nuss“. Sie bewegen sich in einem Zwischenreich, „im Niemandsland zwischen Möglichem und Unmöglichem, zwischen Seiendem und nicht Nicht-Seiendem“. Damit sind sie die „verborgenen Herren der Liturgie geblieben“. Der liturgische Kontext kennzeichnet den ursprünglichen und bei Lehnert (derzeit Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Institutes Leipzig) wieder vitalen Sitz im Leben der Lyrik. Denn Gebet und Gedicht unterscheiden sich kaum und tasten sich in ebendieses Zwischenreich der Engel, mal ritueller, mal freier vor.
Obwohl sich der „Cherubinische Staub“ sowohl im Titel als auch thematisch und (im ersten Teil) formal auf den „Cherubinischen Wandersmann“ des Barockdichters und Priesters Angelus Silesius (1624 bis 1677) bezieht, steht er ihm doch in einem wesentlichen Punkt diametral entgegen: Der Wanderer vertreibt die Engel gleich zu Beginn „Ich will nun euer nicht; ich werfe mich allein / Ins ungeschaffne Meer der bloßen Gottheit ein.“ Lehnert sammelt gleichsam den „Staub“ ein, den der barocke Wandersmann von den Schuhen zu schütteln suchte.
Es mag überraschen, aber Lehnert, der die Religion in den 1990er Jahren nach Jahrzehnten der Abstinenz wieder in die deutsche Poesie eingeführt hat (so Michael Braun bereits 2010), bildet genau mit dieser zunächst nostalgisch wirkenden Intention die Spitze einer Avantgarde. Heinz Schlaffer hat 2012 daran erinnert, dass das Gebet eine elementare Gestalt des Gedichtes sei, Poesie ihrem Ursprung nach die „Muttersprache der Götter“; auch wenn heute niemand daran zweifle, dass die Poesie eine menschliche Erfindung sei, so wäre es zu dieser Schöpfung ohne die gegenteilige Überzeugung nicht gekommen. Lehnert will die kopernikanische Wende der Erkenntnistheorie nicht zurückdrehen, er macht sie sich vielmehr zu Nutze und lässt auf dem verbrannten Feld ontologischer Gewissheiten und metaphysischer Ideologien neue, jetzt subtilere lyrische Pflanzen wachsen, die den Hunger nach letztem Sinn ohne Theorie-Besteck stillen.
„Cherubinischer Staub“ feiert geradezu tänzerisch die schon mit dem Vorgängerband „Windzüge“ einsetzende Befreiung seiner früher in einer Tonhöhe strömenden Sprache zur streng gebundenen Form – ursprünglich im frühantiken griechischen und orientalischen Raum das Mittel der Wahl zur Beschwörung der Götter und Geister. Mit Rhythmus und melodischen Klangfarben evoziert Lehnert poetische Bilder, die auf letzte, unsagbare Dinge zielen. Außersprachliche, dem unbewussten Körperrhythmus (von Atembewegung und Herzschlag etwa) korrespondierende und so euphorisierende Elemente werden heute aufs Neue wirksam und lassen das Heilige spürbar werden. „Das Gedicht ruft ins Leben“, so Christian Lehnert im Interview mit dem Domradio; das, was es im Leser zündet, „ist nicht weniger wirklich als anderes“.
Mit ihrem mystischen Kern stehen die drei Werkteile („Stille ohne Maß“, „Von der Unruhe“ und „Baumgespräche“) in romantischer Tradition und beziehen sich wie diese intensiv auf die Offenbarungs-Erfahrungen Jakob Böhmes („Morgen-Röte im Aufgangk“, 1612). Ihre vielfach wörtliche Zitation im Gedicht ist eine höchst ungewöhnliche Form und zeigt, dass die Werke nicht Genialität demonstrieren wollen (obwohl sie dies gleichwohl tun!), sondern Zeugnis ablegen und sich deshalb auf andere Zeugen berufen dürfen. Dies Zeugnis zielt weniger auf einen (unmöglichen) Beweis göttlicher Existenz als vielmehr auf ein cherubinisches Bestäuben des Menschen, der sich vollkommen ohne Enhancement erneuert: „Jetzt wendet sich das Los und bald verlischt mein Blick. / Es kehrt der Tag bei Nacht, im Schlaf der Mensch zurück / und findet sich gesetzt an seine eigne Schwelle.“ (aus „Mitternacht“)
Gedichte
Frankfurt: Suhrkamp Verlag. 2018
112 Seiten
20,00 Euro
ISBN 978-3-518-42819-1

