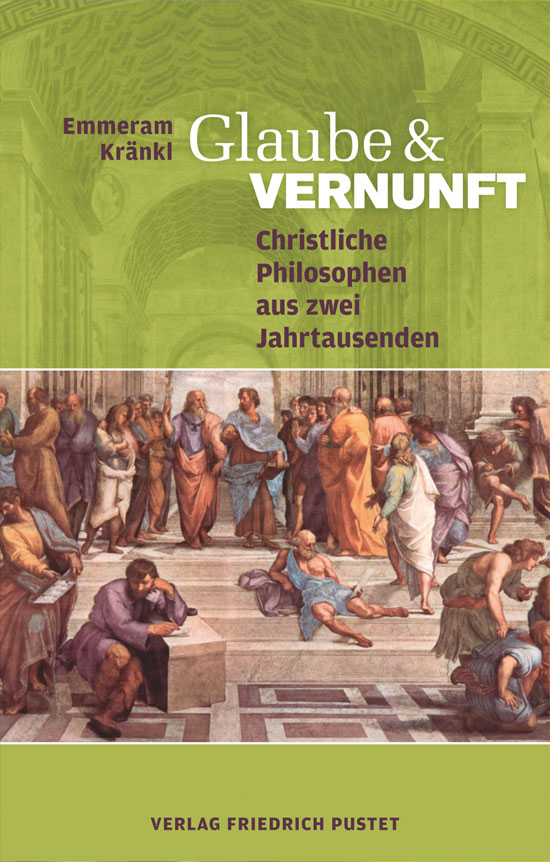
Bestellen
auf Buch7.de - sozialer Buchhandel
Emmeram Kränkl: Glaube & Vernunft
Wer die neutestamentlichen Schriften im Hinblick auf „Glaube und Vernunft“ liest, stößt auf Verwirrendes. So preist Jesus den Vater, weil er das Wesentliche „den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart“ habe (Mt. 11,25). Ähnlich kann Paulus nur davor warnen, sich auf die Weisheit der „Welt“ zu verlassen, denn im Kreuzesgeschehen habe Gott diese Weisheit „als Torheit entlarvt“ (vgl. 1. Kor. 1,18-31). Zugleich kann der Völkermissionar durchaus auf Gedanken der – vorzüglich stoischen – Philosophie zurückgreifen, so, wenn er in den ersten beiden Kapiteln des Römerbriefes auf die alle Menschen verbindende Kraft der (Gottes-) Erkenntnis und des Gewissens verweist. Und Johannes eröffnet sein Evangelium mit einer Meditation über das philosophische Grundwort Logos, um sogleich einen Gegenakzent zu setzen: „Er“, der präexistente Sohn Gottes, „war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht“ (1,10). Wer diese schwierigen, tendenziell „warnenden“ Anfänge bedenkt, kann nur darüber staunen, welch große Energie die christliche Theologie seit ihren Anfängen in die Verhältnisbestimmung Glaube – Vernunft investiert hat, wie unakzeptabel es bis heute scheint, die damit verbundenen Fragen als unlösbar oder gar sinnlos fallen zu lassen. „Fides quaerens intellectum“, der Glaube, der Einsicht sucht – diese Formel des Anselm von Canterbury (1033–1109) bleibt ein beständiger Leitvers der christlichen Geistesgeschichte.
Emmeram Kränkl, von 1987 bis 2006 Abt des Benediktinerstifts St. Stephan in Augsburg und seitdem auch Philosophielehrer am Benediktinergymnasium Schäftlarn, betrachtet „christliche Philosophen aus zwei Jahrtausenden“. Er gliedert diesen langen Zeitraum klassisch in „Antike“, „Mittelalter“, „Neuzeit“, was insgesamt – von Justin (um 110-168) bis Charles Taylor (*1931) – rund 50 konzise Porträts samt exemplarischen Textausschnitten und Erläuterungen ergibt. Mit der Frage, ob es überhaupt eine christliche Philosophie geben könne, ob sie nicht, wie ein starkes Wort von Martin Heidegger kündet, ein „hölzernes Eisen“ und ein „Missverständnis“ sei, beschäftigt sich der Autor nicht unmittelbar.
Mit dem Philosophen und Märtyrer Justin verweist er gleich am Anfang auf einen Denker, dem Heideggers Diktum kaum zu vermitteln gewesen wäre. Denn nach langen philosophischen Studien war Justin zu der Überzeugung gelangt, dass erst im Christentum die in der Philosophie angelegten „Keime“ der göttlichen Wahrheit ihre Frucht ausbilden konnten. Doch verweisen die Keime auf die künftige Frucht, und so räumte Justin der Philosophie Platons auch im christlichen Denken einen wichtigen Platz ein. Als ein äußeres Zeichen für diese Vereinbarkeit trug er bewusst das Pallium, das Gewand der Philosophen. Nach einer Vorstellung wichtiger christlicher Denker der Antike – der letzte ist Johannes von Damaskus (um 650–754) – betont Kränkl ihre grundsätzliche Unbefangenheit der „heidnischen“ Philosophie gegenüber wie ihr Selbstbewusstsein: „Vorbild sei die Biene, die aus den verschiedensten Blüten das für sie Brauchbare heraussauge (Basilius). Dabei wird nahezu einmütig die (neu-)platonische Philosophie als die dem Christentum nahestehendste bezeichnet (…).“
Die lange Epoche des Mittelalters, die Kränkl mit einem Porträt von Johannes Scotus Eriugena (um 810–877) eröffnet und mit Nikolaus von Kues (1401–1464) beschließt, war eine überraschend vielfältige Zeit. Geistesgeschichtlich bedeutsam wurde die Wiederentdeckung der antiken Grundschriften, vor allem der logischen Abhandlungen des Aristoteles. Die scholastische Methode des „Sic et non“, des Für und Wider, trug zur Bändigung allzu forscher Spekulationen und zur Herausbildung von „Systemen“ bei. Natürlich stellte hierbei Thomas von Aquin (1224–1274) mit seinen beiden „Summen“ eine erstrangige Größe dar. Doch entwickelten auch Petrus Abaelard (1079–1142), Roger Bacon (1220–1292) oder Nikolaus von Kues differenzierte, bis heute anregende Überlegungen. So stellt Kränkl mit dem Verweis auf Abaelards „Dialogus inter philosophum, Iudaeum et Christianum“ fest: „Durch die Vernunft könne jeder Mensch zur Wahrheit und damit auch zum Heil finden, unabhängig von seiner Religion und Weltanschauung. Damit nimmt Abaelard die Gedanken von Lessings Nathan dem Weisen, aber auch die Ausführungen des II. Vatikanums über die verschiedenen Religionen als Heilsweg vorweg und eröffnet damit den Weg zum Dialog der Religionen auf Augenhöhe.“
Über die „bürgerliche“ Renaissance und den Humanismus, der nicht zuletzt durch die Ablösung der katholischen Kirche als der allbestimmenden Kraft gekennzeichnet war, nähert sich der Autor der Neuzeit. Auch in dieser Periode, die – bis jetzt! – gut fünf Jahrhunderte umfasst, versuchten Denker wie Blaise Pascal (1596-1662), John Henry Newman (1801-1890), Edith Stein (1891-1942) oder Bernhard Welte (1906-1983) die immer rasanteren Entwicklungen und Sprünge der „Moderne“ mit der christlichen Botschaft in einen nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen. Das kann selbstverständlich nicht abschließend gelingen. Umso mehr gilt, was Johannes Paul II. (1920-2005) im ersten Satz seiner Enzyklika „Fides et ratio“ (1998) bildhaft festhält: „Glaube und Vernunft (Fides et ratio) sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt.“ Man mag einen solchen Satz als fromm und idealistisch bezeichnen. Der Blick auf Emmeram Kränkls „Christliche Philosophen aus zwei Jahrtausenden“ zeigt aber, dass es zu „Fides quaerens intellectum“ keine Alternative gibt. Das lässt sich anhand dieses Buches auch Schülern im Religions- oder Philosophieunterricht sinnvoll vermitteln. Und der Leser, der sich in diesem Band grundlegend über Petrus Abaelard oder Charles Taylor informiert, wird dann idealerweise zu Originalwerken greifen, zu Abaelards „Dialogus“ beispielsweise oder zu Taylors „Ein säkulares Zeitalter“.
Christliche Philosophie aus zwei Jahrtausenden
Regensburg: Friedrich Pustet Verlag. 2018
327 Seiten
29,95 €
ISBN 978-3-7917-2753-0

