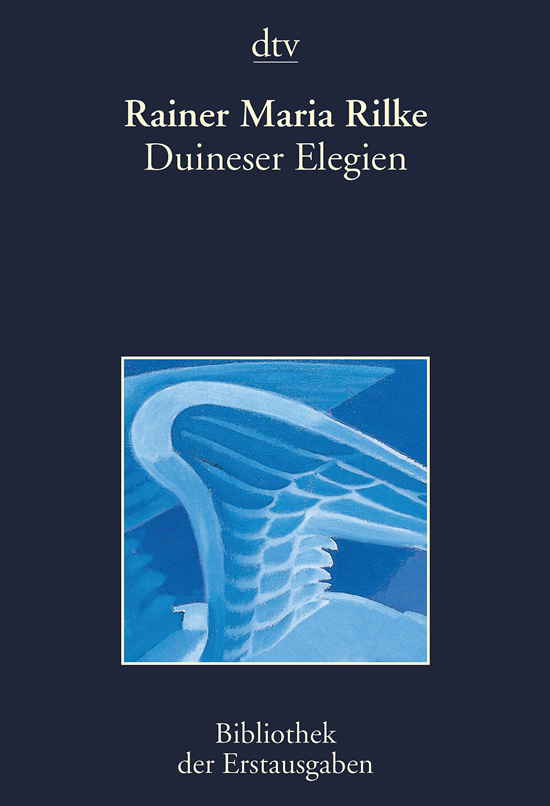Neu gelesen
Die Rede vom Engel bei Rainer Maria Rilke
Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der
Engel / Ordnungen?“ Was für ein Auftakt für eine der
bekanntesten Gedichtzyklen in deutscher Sprache! Mit
dieser poetischen Frage klingt das erste jener insgesamt
zehn Gedichte an, die Rainer Maria Rilke (1875-
1926) unter den Titel der „Duineser Elegien“ stellen
wird. 1912 auf dem Schloss Duino an der Adria in der
Nähe von Triest entstanden, bricht der Text eine Szenerie
auf, in der Mensch und Engel einander radikal gegenüberstehen.
Zwei „Ordnungen“ werden beleuchtet,
deren Ziel darin liegt, den Menschen in seiner Verlorenheit,
Zerrissenheit und Einsamkeit umso deutlicher
zu profilieren.
Ein jeder Engel ist schrecklich
Engel? Wer harmlose Bilder von schützenden Mächten
erwartet, wer tröstende Vorstellungen von geflügelten,
unser Leben begleitenden Gottesboten sucht, der sollte
die verstörenden, aufrüttelnden, auch fast 100 Jahre
nach ihrem Entstehen rätselhaft bleibenden Verse Rilkes
lieber meiden. Denn was zeichnet die hier lyrisch
entworfenen „Engel“ aus? Gewiss, sie sind ganz anders
als wir Menschen in ihrem „stärkeren Dasein“, gewiss,
sie sind „schön“. Aber: „das Schöne ist nichts als des
Schrecklichen Anfang“, so die erste Elegie in den ersten
Versen. Mit dem Motiv „Schrecken“‚ ist ein zentraler
Zug der Engel-Zeichnung Rilkes benannt: „Ein jeder
Engel ist schrecklich.“
Dieser Vers bildet zugleich den Auftakt der zweiten
Elegie, die ganz den Engeln gewidmet ist, ihnen,
den „fast tödlichen Vögeln der Seele“. Mit der Frage
„Wer seid ihr?“ schließt die erste Versgruppe. Und
dann zeichnet Rilke nie gelesene poetische Bilder, um
seine „Engel“ zu beschreiben: „frühe Geglückte“ der
Schöpfung, nennt er sie; „Verwöhnte der Schöpfung“;
„morgenrötliche Grate aller Erschaffung“; „Pollen der
blühenden Gottheit“; „Gelenke des Lichts, Gänge, Treppen,
Throne, Räume aus Wesen, Schilde aus Wonne,
Tumulte stürmisch entzückten Gefühls“. Wozu diese
überquellenden Bilder? Wozu diese immer wieder neu
ausgeloteten Grenzgänge an die Trennlinie von Verstehen,
Erahnen und Sinnsprengung?
Spiegel
Romano Guardini, ein erster großer einfühlsamer theologischer
Rilke-Deuter, zählte gerade diese Sprachsetzungen
zu den „großen Leistungen seherischer Dichtung“.
Heute urteilt man nüchterner. Rilkes Engel sind
kaum zu deuten als theologischer Beitrag zur Angelologie,
sondern vor allem poetische Chiffren zur Selbstdeutung
des Menschen. Auch wenn Rilke in seinen Gedichten
von „Gott“ spricht, geht es – zumindest primär
– nicht um Glauben und Religion, sondern um eine lyrische
Selbstbesinnung.
Denn was sind die Engel, der zweiten Elegie zufolge?
„Spiegel“ – im Text zur Betonung der Bedeutung kursiv
gesetzt! Was spiegeln sie? Zunächst sich selbst, schöpfen sie doch „die entströmte eigene Schönheit zurück
in das eigene Antlitz“. Die von ihnen ausgestrahlte, von
Menschen wahrnehmbare Schönheit fließt in sie selbst
zurück. In diesem Prozess erkennt der Mensch sich
jedoch umso genauer. Darum geht es in den Elegien:
Im Bilde des lyrisch entworfenen Engels – wie auch
in anderen Zentralmotiven wie den „Tieren“ oder den
„Liebenden“ – wird das Bild des Menschen gespiegelt
in neuer Schärfe und Klarheit. Im Spiegel dieser vom
Menschen unterschiedlichen Daseinsform, die uns etwas
voraus hat, die eine Vollkommenheit umfasst, der
wir uns bestenfalls sehnsuchtsvoll annähern können.
Staune, Engel!
Die siebte Elegie, zehn Jahre nach den beiden ersten
verfasst, geht einen Schritt weiter. Das lange Ringen
Rilkes mit den Duineser Elegien, mit ihren Bildern,
Themen und Motiven bleibt nicht in dieser ernüchternden
Beschreibung des menschlichen Schicksals
stehen. Jenseits aller Trennung, aller Abgeschiedenheit
von der Welt der uns so unendlich überlegenen „Engel“
gibt es doch eines, was der Mensch dem Engel zeigen
kann. Er, nur er hat die Fähigkeit, die Dinge innerlich
anzuschauen. Er birgt das Angeschaute in seinem Denken
und Dichten und gibt ihm so einen eigenen Sinn:
„Engel / dir noch zeig ich es, da! In deinem Anschaun
/ steht es gerettet zuletzt“. Das Anschauen und
die Verwandlung in zeitüberdauernde Worte, das ist es,
was der Mensch, was der Dichter kann, und was ihn
der Ordnung der Engel wenigstens etwas näherbringt.
„War es nicht Wunder? O staune, Engel, denn wir
sinds, / wir o du Großer, erzähls, dass wir solches vermochten“.
Nein, damit verschwimmen die bleibenden
Grenzen zwischen den Ordnungen der Menschen und
der Engel nicht. „Engel … du kommst nicht. Denn mein
Anruf ist immer voll Hinweg“, weiß auch der Sprecher
der siebten Elegie. Und doch hat sich der Ton verändert.
„Bleiben ist nirgends“, heißt es in der ersten Elegie,
„Hiersein ist herrlich“ nun in der siebten. Die Welt
der Engel: sie bleibt ein Gegenüber, aber zumindest
der „Hinweg“ zu ihr scheint möglich.
Selbstreferenz – Entknüpfung – Überstieg
In einer gründlichen, neuen Untersuchung hat der Kölner
Theologe Norbert Stapper frühere Texte Rilkes, die
„Christus-Visionen“, theologisch-literarisch analysiert.
Er arbeitet dabei überzeugend drei Kategorien heraus,
die das poetische Verfahren Rilkes im Umgang mit religiösen
Bildern und Vorstellungen beschreibt: Selbstreferenz,
Entknüpfung und Überstieg. Diese Kategorien
lassen sich auch auf den späteren Einsatz von „Engeln“
übertragen:
Selbstreferenz – Die Rede von Engeln erhält ihre poetische
Bedeutung ausschließlich im Kontext der inneren
Sprachwelt der Duineser Elegien. Sie verweisen nicht auf etwas Anderes, haben keine „Botschaft“, lenken
den Blick vielmehr ganz auf den Bereich des dichterischen
Entwurfs, auf sich selbst. Entknüpfung –
Die aufgerufenen religiösen Vorstellungen von Engeln
aus dem jüdisch-christlichen Traditionsschatz bilden
bewusst den Hintergrund. Gleichzeitig löst Rilke seinen
eigenen dichterischen Gebrauch aber von diesen
Vorstellungen ab. Aus der bleibenden Spannung von
Anknüpfung und Loslösung ergibt sich die geistige
Dynamik dieser Texte. Überstieg – Trotz allem weisen
die Gedichte über sich hinaus, öffnen einen Raum des
Numinosen, der sich freilich nicht genau definieren
lässt. Sie lösen eine Bewegung aus, die über die reine
Textwelt hinausgehen kann.
Engel als Weg zur Selbsterforschung
Rilke ist kein „christlicher Dichter“. Sein formeller Austritt
aus der katholischen Kirche 1901 ist mehr als eine
Protesthandlung gegen die eng-repressive religiöse
Welt seiner Kindheit und Jugend. Er bleibt ein Suchender,
ein gegenüber dem Spiritismus seiner Zeit Aufgeschlossener,
ein seine eigene religiös-dichterische Welt
Entwerfender, die sich einer theologischen Klassifikation
bleibend entzieht. Bei aller vermeintlichen Nähe
in Motivwahl und Sprachsetzung bestätigt Rilke in
seinen Texten also nicht einfach eine kirchliche Wirklichkeitsdeutung.
Rilkes Gedichte entwerfen eine eigene Welt. Seine
„Engel“ spiegeln in ihrer Gleichzeitigkeit von Andersartigkeit
und Schönheit auf der einen, Unerreichbarkeit
und Schrecklichkeit auf der anderen Seite unsere
Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen. Ob es Engel „gibt“,
welchen „ontologischen Status“ man ihnen zugesteht –
solche Fragen wären an Rilkes Texte fehlgerichtet. Ein
Nachdenken und Nachspüren der Überlegung, wie wir
Menschen uns im Bilde der Engel selbst begreifen können,
das freilich kann man in der immer wieder verstörenden
Lektüre der Duineser Elegien neu erfahren.
Zur Person
Georg Langenhorst
ist Professor für Didaktik des Kath. Religionsunterrichts und Religionspädagogik an der Universität Augsburg. 2011 erschien von ihm ein Praxis-Handbuch „Literarische Texte im Religionsunterricht“
(Verlag Herder).