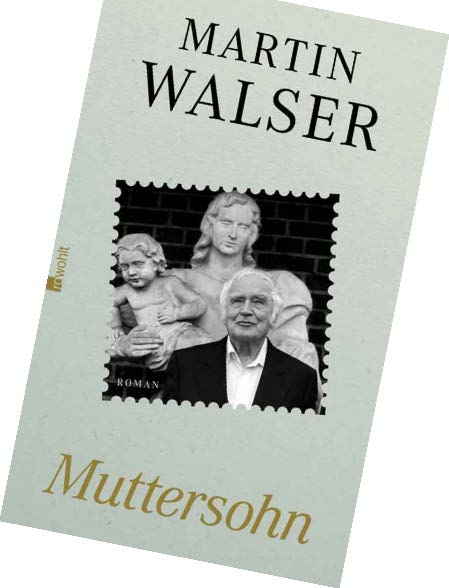Der weiße Schatten
Martin Walsers Roman „Muttersohn“
Frage: „Wie heißt nochmal der letzte Walserroman?“
Antwort im Brustton der Gewissheit: „Menschensohn“. –
„Menschensohn? Ich dachte immer ‚Muttersohn‘.“
Natürlich heißt er „Muttersohn“. Der Titel ruft sofort
negative Konnotationen und Schablonen auf: „Hotel
Mama“, fehlgeschlagene Abnabelung, psychopathologische
Fixierungen, Ödipuskomplex. Walser hat in
seinem Roman „Die Verteidigung der Kindheit“ schon
einmal einem speziellen Muttersohn ein literarisches
Denkmal gesetzt: Alfred Dorn, der nie erwachsen werden
will, weil die Zukunft ihm nur Verfall und Tod
bringen würde. An ihm ist das Leben vorbeigezogen,
er zerbricht an einem obsessiven Vergangenheitskult
um seine Mutter. Alles, was sie berührt hat, ist ihm
heilig. Am Ende, noch bevor er sich das Privatmuseum
mit den Devotionalien seiner Kindheit einrichten kann,
stirbt er mehr oder weniger zufällig durch unkontrollierten
Tablettenkonsum, weil ihm die Zeit immer wieder
entgleitet.
Percy, die Hauptfigur im „Muttersohn“ ist ganz und
gar kein Epigone Alfreds. Seine Mutter Josefine behauptet,
ihren Sohn ohne das Zutun eines Vaters empfangen
zu haben. Eine zweite Jungfrauengeburt also.
Percy ist ein Sohn von Mutter Fini, einer einfachen
Frau, die im Leben nichts hat als die Gewissheit, eine
„Geführte“ zu sein. Wenn es in ihrem Umkreis wieder
ganz fürchterlich ist, bewahrt sie eine unbestimmte
Sehnsucht nach dem erlösenden Wort der Liebe und
des Trostes. Percy ist die fleischgewordene Erfüllung
ihrer Sehnsucht, das Ergebnis ihrer mystischen Vereinigung
mit einer männlichen Idealgestalt in einer
intensiven erotischen Liebesvision. In diesem emphatischen
Sinn ist er ausschließlich der Sohn einer Mutter,
ein Muttersohn also, kein Muttersöhnchen.
» Percy ist der Anwalt des Lebens. «
Percy geht ganz und gar in der Gegenwart auf. Sein Gang ist bei aller Körperfülle so schwebend wie der
eines Engels ohne Flügel. Nach einem Unfall am Heiligen
Abend wird er aus dem verschneiten Straßengraben
von einem Pfarrer gerettet. Das ist wie eine
Fügung, eine zweite Geburt. Wir erfahren über seinen
Werdegang lediglich so viel, dass er in der psychiatrischen
Anstalt seines väterlichen Freundes Prof. Augustin
Feinlein den Beruf des Pflegers erlernt hat, dass
er das südliche Deutschland von Heilanstalt zu Anstalt
durchwandert und dass er sich dort jeweils den Menschen
zuwendet, die in der Tat mühselig und beladen
sind, weil sie den gängigen Normen psychischer Gesundheit
nicht entsprechen und abgesondert von den
anderen Menschen leben müssen. Seine Therapien sind
ungewöhnlich, intuitiv und wohltuend. Er tut immer
das Richtige zur rechten Zeit. Kranke werden von Stimmen
verfolgt und nach dem Prinzip des „similia similibus
curantur“ von Percy wieder in eine Art seelisches
Gleichgewicht gebracht, indem sie religiöse Texte bis
zur Erschöpfung aufsagen müssen und die quälenden
Stimmen damit zum Verstummen bringen. Er weiß,
wann er sprechen darf und wann er schweigen muss.
Von ihm gehen Energien aus, welche die Selbstheilungskräfte
von todgeweihten Krebspatienten auferwecken.
Selbst schwierigste Fälle bekommen wieder
eine Lebensperspektive, weil Percy sie annimmt, wie
sie sind. Das spüren sie, weil es ihnen wohltut. Percy
ist der Anwalt des Lebens.
Percy hat keinen festen Wohnsitz; befreundete Pfarrer
gewähren ihm gelegentlich Obdach auf seinen Touren.
Dafür predigt er dort von Zeit zu Zeit, spontan,
ohne intellektuelle, dogmatische oder rhetorische Vorbereitung;
er stimmt sich mit Orgelimprovisationen
innerlich ein und trifft dann mit seinen Worten immer
genau ins Seelenzentrum seiner Zuhörer, so dass sie
innerlich gestärkt von dannen ziehen, ohne dass man
sagen könnte, worin seine Lehre oder sein Programm
genau bestehen würde. Dabei fallen charismatische
Sätze.
Außer einem alten Lederhut und einem Rucksack
besitzt Percy fast nichts. Am Ende hat er durch sein
bloßes So-Sein die Feinde des Lebens, eine Motorradgang,
provoziert, die sich dem Hass und der absoluten
Negation verschrieben hat, Mordaufträge entgegennimmt
und für Hinrichtungen trainiert. Das Fernsehen
hat darüber berichtet. Nun möchte die Gang Percy
„umpolen“ und sein Charisma für ihre Ziele instrumentalisieren.
Da Percy nicht darauf eingeht und es zulässt,
dass auch über seine Person eine Art Gegenfilm
gesendet wird, will der Anführer der „Jollynecks“, eine
Art Antichrist, ihn erschießen, drei Tage nach der Beerdigung
ausgraben, den Leichnam verschwinden lassen
und Percys Auferstehung und Himmelfahrt simulieren.
Percy ahnt seinen Tod voraus, da man ihn vorgewarnt
hat. In seiner letzten Predigt wendet er sich in eigener
Sache an die Zuhörer:
„Lass mich nicht allein. So schaff ich mir ein Gegenüber.
Das nicht da ist. Das es aber gibt. Sonst könnte ich
doch nicht sagen: Lass mich nicht allein. Wir sagen etwas,
und dadurch machen wir etwas. Ich sage diesen
Satz heute zum ersten Mal. Es ist ein bittender Satz,
kein befehlender. Lass mich nicht allein. Wir hören das
Bittende, das Flehende. Und wenn ich ihn sage, dann
spüre ich, dass ich dazugehöre, zu denen, die nicht
alleingelassen werden wollen. Aber ich bin ja schon
allein gelassen worden, sonst hätte ich den Satz nicht
sagen können. Es herrscht ein Mangel.“ (S. 485)
» Religion produziert Schönheit. «
Trotz dieser „Ölbergsstimmung“ setzt er seine Waldwanderung
am Heiligen Abend fort und wird vom Anführer
der „Jollynecks“ vom Motorrad aus mit einem
gezielten Genickschuss geradezu hingerichtet. Dieser
stürzt sich dabei selber zu Tode, weil der Wanderstock
Percys zwischen die Speichen gekommen ist. Mutter
Fini bleibt angesichts der Todesnachricht relativ unbeeindruckt.
Percys Biografie macht plausibel, wie es zu dem Irrtum
„Menschensohn“ kommen konnte. Es wäre schon
eine verführerische Angelegenheit, in einer kirchlichen
Zeitschrift Walsers „Muttersohn“ als einen camouflierten
Jesusroman in der Tradition von Dostojewski
vorzustellen. In der Tat wird hier virtuos mit
zahlreichen religiösen Andeutungen und Gegenbesetzungen
gespielt. Percys absolute Präsenz in der Gegenwart,
seine absolute Humanität, seine Bereitschaft,
sich für alles Leiden in und an der Welt durchlässig
zu machen, indem er an dem Satz „Dem Leben zuliebe“
wie an einem Mantra festhält, erinnern an den Hoheitstitel
des Heilands.
Martin Walser hat kürzlich Religion und Literatur
als zwei Seiten einer einzigen Medaille bezeichnet, „die
unser Dasein heiße“. Diese Äußerung setzt ein Ausrufezeichen
unter die Debatte über seine beiden letzten
Bücher „Mein Jenseits“ und „Muttersohn“, denen nachgesagt
wird, Walser sei in seinem Spätwerk fromm
und altersmilde geworden. Wer Walsers scharfe Abrechnung
mit der vorkonziliaren Moralerziehung der
katholischen Kirche aus dem Roman „Ein springender
Brunnen“ noch vor Augen hat, mag sich in der Tat über
einen neuen Ton wundern. Mit seinem Vergleich zwischen
Literatur und Religion markiert Walser jedoch
sein jahrzehntelanges persönliches „Gottesprojekt“,
eine Erfahrungen mit dem Wort „Gott“, das ihn in immer
neuen Variationen beschäftigt hat. Er legt folgende
Worte Augustin Feinlein, dem ärztlichen Direktor der
psychiatrischen Anstalt in Scherblingen, in den Mund:
„Warum glauben wir? Weil uns etwas fehlt. (…) Glauben
heißt Berge besteigen, die es nicht gibt. (…) Wenn
es Gott nicht gäbe, könnte man nicht sagen, dass es
ihn nicht gibt. Wer sagt, es gebe ihn nicht, hat doch
schon von ihm gesprochen. Eine Verneinung vermag
nichts gegen ein Hauptwort.“ (Mein Jenseits, Berlin
2010, S. 112)
Das könnte Walser wohl auch für sich selber proklamieren.
Wer Augen hat zu lesen, wird in Walsers
Werk reichliche Hinweise dafür finden, dass ein „spannungsloser Atheismus“, der die zweitausend Jahre
virulente Gottesfrage und die damit verbundene
Frage nach der Rechtfertigung des Menschen, ausblendet
seine Sache nie gewesen ist. Vielmehr interessiert
er sich für die „Geschichte zur Transzendenz hin“, die
sich in Kunst, in Musik, Sprache und im Kult manifestiert.
Diese schöpferischen Objektivationen verleihen
uns in seltenen kostbaren Momenten plötzlich
das utopische Gefühl, der elementare metaphysische
Mangel des Daseins sei doch zu überwinden. In einem
früheren Roman heißt es: „Musik ist das Gegenteil von
im eigenen Saft schmoren. Welche Einbildung von Vermögen
Musik bewirkt, drückt sich am deutlichsten
aus in der Armut, die sich in einem ausbreitet, wenn
die Musik vorbei ist.“ (Die Verteidigung der Kindheit,
1991, S. 46f.)
In „Muttersohn“ sind sowohl die bildende Kunst, die
Reliquien als auch Orgel- und Chormusik die Brücke
zwischen immanentem Mangel und transzendenter
Erfüllung. Die Chorleiterin Elsa Frommelt führt nicht
nur Oratorien auf, sie bringt ihre Sänger bei den kräftezehrenden
Proben dazu, ganz bei sich zu sein und
so zu singen, wie es ihnen selbst bis dato unmöglich
erschien. Sie singen geradezu über sich hinaus. In einer
Bachfuge werden die Stimmen nach dem Gesetz
der Kunst der Fuge über-neben-untereinander geführt,
sie klingen polyphon im Ganzen zusammen, bleiben
aber als distinkte Einheiten immer selbstständig hörbar.
Das ist dialektisch, das ist schön, und in der Erfahrung
absoluter Schönheit im Schauen und Hören
leuchtet punktuell die Möglichkeit der metaphysischen
Mangelüberwindung auf, so wie der Sonnenglanz aus
Wolkenlöchern hindurchbricht. Religion produziert
Schönheit. In der Kunst teilt sie sich uns mit: „Es ist
schön, etwas zu glauben. Auch wenn’s nie für lange
gelingt. Manchmal nur eine Sekunde, und weniger als
eine Sekunde. Aber eine Sekunde Glauben ist mit tausend
Stunden Zweifel und Verzweiflung nicht zu hoch
bezahlt.“ (Mein Jenseits, S. 113)
Um dieses kostbaren „nunc stans“ willen lässt
Walser seine Romanfiguren immer wieder musizieren
oder Kunstbetrachtungen anstellen, etwa über die
schwebende Sixtinische Madonna, Caravaggios Pilgermadonna
oder Parmigianinos „Madonna mit der Rose“.
Die Romanfiguren beziehen die Kunst ganz und gar auf
ihr eigenes Leben und spiegeln sich darin. Sie gehen
in der Schönheit auf und machen die Erfahrung, dass
Transzendenz möglich sei. Walser ist dabei oft nicht
frei von Ironie, wenn seine Helden das Geschlechtsteil
des dargestellten Jesusknabens mit einem Krabbencocktail
vergleichen oder wenn sie sich anhand
der schmutzigen Füße des Pilgerpaares auf dem Gemälde
hochgradig metaphysische Gedanken machen.
Als Mutter Fini, die immer schon praktisch veranlagt
war, die Urne mit der Asche ihres „Idealmannes“ überbracht
wird, sagt sie zu Percy: „Stell sie dort auf die
Kommode. Mir fehlen sowieso immer Aschenbecher.“
(Muttersohn, S. 453)
Ironie bedeutet aber nicht Unernst. Ironie eröffnet
die Erfahrung eines gedoppelten Bezugs zur Handlung,
indem der Leser die vorgeführten Inhalte mit
dem sprachlichen Modus in Beziehung setzen und
sich fragen muss, wann etwas direkt und wann etwas
indirekt angedeutet wird. Man muss zwischen Gesagtem
und Gemeintem, zwischen Teil und Gegenteil
unterscheiden können, und das geht nur, wenn man
den „dunklen“ Untergrund, auf den sich Ironie bezieht,
kennt. Ironie ist eine Art Vorbehalt, sich nicht,
z.B. durch vorgefasste Worthülsen, vereinnahmen zu
lassen; sie erleichtert die Distanznahme des Lesers.
Man muss Walsers manchmal recht skurrile Helden
nicht sympathisch finden, man kann über ihre bizarren
Ideen den Kopf schütteln. Es lohnt sich jedoch darüber
nachzudenken, inwiefern ihnen mehr Exemplarisches
anhaftet als allen anderen, die im Mainstream munter
mitschwimmen. Mit seiner Ironie legt Walser die
Romanfiguren wie unter ein Vergrößerungsglas, damit
bestimmte Details ihres Lebens schärfer hervortreten
können. Ironie ist das Signal für den Leser, auf die existentielle
Gegebenheit des Menschen aufmerksam zu
werden und sich auch selber wiederzuerkennen. Als
Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Existenz
überhaupt führt Walser den Begriff des Mangels ein.
Das Bewusstsein des Mangels und die Versuche zu seiner
Überwindung sind das treibende Moment in vielen
Texten Walsers. In Percys Worten: „Die Welt ist eine
Missgeburt, darum liebe ich sie so.“ (S. 502) Walsers
Romanfiguren mangelt es an Liebe und Anerkennung,
an Reinheit des Gewissens, an Kindheit, an Zukunft,
an Glaubensgewissheit; sie leiden unter ihrer moralischen
Insuffizienz, an Sprachlosigkeit oder an einer
Trägheit des Herzens. Immer besteht ein großer Abstand
zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, wie
es sein sollte oder sein könnte.
Den Kafkaleser Walser interessieren Figuren wie
Josef K., der an seinem 30. Geburtstag Rechenschaft
über sein Leben geben soll. Er kann es nicht, er fühlt
einen Mangel an Rechtfertigung und er kann sich mühen
wie er will, er wird nie damit zu Rande kommen.
Die Umkehrung der Rechtfertigungsproblematik des
sündigen Menschen vor Gott ist die Theodizeefrage
als Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts
des Leidens in der Welt. Sowohl das unlösbare Problem
der Rechtfertigung des Menschen vor Gott wie
auch die Unmöglichkeit einer letzten Beantwortung
der Theodizeefrage führen zur religiösen Paradoxie,
„zur Hoffnung auf keine Hoffnung hin“, also zu einem
Glauben, der Widersprüche, das schlechthin Inkommensurable,
gegen den Einspruch einer jederzeit erklärungsbereiten
Vernünftigkeit aushalten kann. Diese
Glaubensmöglichkeit verkörpert Percy
mit großer Authentizität und Gelassenheit.
Sie hilft ihm dabei, provozierendtaktlose
Fernsehinterviews souverän
zu bestehen und das sensationslüsterne
Publikum letztlich für sich zu gewinnen.
Glauben wider alle Vernunft ist auch der
Kern des Reliquienkults seines geistiggeistlichen
Ziehvaters Augustin Feinlein.
Der elementarste Mangel, den Menschen
an sich erfahren, ist die eigene Sterblichkeit.
Der Frankfurter Philosoph Herrmann
Schrödter hat Religion als „Ausdruck und
Erscheinung des Bewusstseins radikaler Endlichkeit
der menschlichen Existenz und deren
realer Überwindung“ definiert und damit die
große Bedeutung dieser condition humaine angesprochen.
Das Bewusstsein radikaler Endlichkeit
generiert Religion als eine große Erzählung
von dieser condition humaine und versucht Antworten
auf die sogenannten „großen Fragen“ nach
Gott, Seele, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Bibel
ist neben anderem auch ein literarisches Kunstwerk.
Sie erzählt Geschichten von erlesener Schönheit,
wie z.B. die Weihnachtsgeschichte. Gleichnisse,
Genealogien, Psalmen, Liebeslyrik exemplifizieren
die radikale Bedingtheit und die Suche nach Rechtfertigung
des Menschen ebenso wie den radikalen
Zuspruch Gottes im Horizont einer transzendenten
Wirklichkeit. Im realen Alltag stellen schmerzliche
Erfahrungen einen Vorschein auf diese letzte große
Endlichkeit dar. Persönliches Scheitern, unerfüllte
Liebe, zusammenstürzende Lebenspläne, Verlusterfahrungen,
tückische Krankheiten sind „kleinere Endlichkeiten“
im Dasein, die den Menschen mit seinen
Grenzen bekannt machen und die Sinnfrage aufleben
lassen. Dieses Spannungsverhältnis ist nicht nur religionsgenerativ,
sondern auch literarisch produktiv,
denn Literatur stellt fiktive Figuren in den Kreuzpunkt
kleiner und letzter Endlichkeitserfahrungen, an denen
sie scheitern oder sich bewähren können. Die Sehnsüchte
vieler Romanfiguren Walsers verweisen auf
diese Spannung.
Zu Walsers 85. Geburtstag hat der Fernsehsender
3Sat einen wunderbaren Film gezeigt. Walser spricht an einer Stelle davon, dass seine Romane am Ende einen
„weißen Schatten“ werfen. Das ist ein schönes Bild.
In der empirischen Welt der Naturgesetze gibt es keinen
weißen Schatten. Da ist ein weißer Schatten so etwas
wie ein schwarzer Schimmel. Die fiktionale Welt
muss sich an empirische Gepflogenheiten jedoch nicht
halten. Sie muss nicht geschlossen, widerspruchsfrei
und konsistent sein. In ihr kann es weiße Schatten
geben. Der weiße Schatten ist das Versöhnliche, das
den schrecklichen Ausgang eines Plots übersteigt und
einen transzendenten Fluchtpunkt aufzeigt. In diesem
Sinn schließt Walser an die Tradition der antiken Tragödien
an. Auch hier stehen Figuren im Kreuzpunkt
zweier Notwendigkeiten (Hegel) und sind daher dem
tragischen Untergang ausgeliefert. Wie auch immer sie
sich entscheiden, sie werden immer Schuld auf sich laden,
sie werden geradezu schuldig, wenn sie sie – wie
bei Ödipus – vermeiden wollen. Am Ende der Tragödien
ist die göttliche Weltordnung wiederhergestellt.
Der göttliche Fluch, Reaktion auf menschliche Hybris,
hat sich erfüllt, bis Schuld und Sühne wieder austariert
sind.
Welchen weißen Schatten wirft „Muttersohn“, obwohl
er tragisch ausgeht? Zunächst wird jährlich an
Percys Todestag ein Konzert gegeben, an dem Hunderte
von Sängern und Sängerinnen teilnehmen und
die Klosterkirche zum Schweben bringen: „Jedes Jahr
mit noch mehr Stimmen, bis es keine Zuhörer mehr
gibt. Nur noch Singende.“ (S. 501) Wenn Musik solche
Schönheit hervorruft, dann senden und empfangen
alle Teilnehmer auf einer religiösen Frequenz. Chorerziehung
wäre dann eine Seelenführung ganz im Sinne
des Verstorbenen. Es wird gezeigt, dass alle Menschen
„religiös musikalisch“ sein können, wenn man sie nur
dazu ermutigt.
Auf Percys Beerdigung heißt es: „Das ebenso anmutige
wie rücksichtsvolle Rätsel, mit dem Anton Percy
Schlugen sein Zurweltkommen umgeben habe, sein
furchtbarer Tod und der durch nichts zu erschütternde
Glaube seiner Mutter, das gebe unserer Trauer
einen hellen Ton.“ (S. 500)
Percy ist kein Opferlamm wie Jesus. Er kennt den
himmlischen Vater nicht. Für ihn kommen mehrere
Wahlväter in Betracht. In Todesangst faltet er nicht
einmal die Hände, um jede Verwechslung auszuschließen.
Hybris kennt er nicht. Er kennt seine eigenen
Grenzen. Wenn er auch nicht Jesus ist, so verkörpert
Percy doch die Utopie eines „neuen“ Menschen, der auf
„keine Hoffnung hin dennoch an der Hoffnung festhält“
(K. Barth). In diesem übertragenen Kontext machen
Jungfrauengeburt und Auferstehung Percys Sinn.
In der empirischen Welt sind das Antinomien. Der
Roman aber kann sie, wenn auch ironisch gebrochen,
auflösen: „Keine Angst, habe die Mutter (auf Percys Beerdigung,
Anm.) gesagt, der kommt wieder. Sie kenne
ihren Percy: der verschwindet, und auf einmal ist er
wieder da.“ (S. 500).
Der Glaube an die reale Auferstehung ist die radikalste
Antwort nicht nur auf die große Endlichkeit,
sondern auch auf die kleinen. Kein Mangel! Er ist die
zugleich schwierigste und schönste christliche Hoffnung
auf die Wiederherstellung der Weltordnung. Dort
gelten andere optische Gesetze. Der weiße Schatten des
Muttersohns ist dafür ein versöhnliches Beispiel. Mit
ihm hat Martin Walser sein „Gottesprojekt“ für sich
und seine Leserinnen und Leser beeindruckend und
wunderbar vorangebracht.
Zur Person
Susanne Nordhofen
ist Fachleiterin für Philosophie/
Ethik und Deutsch am Studienseminar in Offenbach.