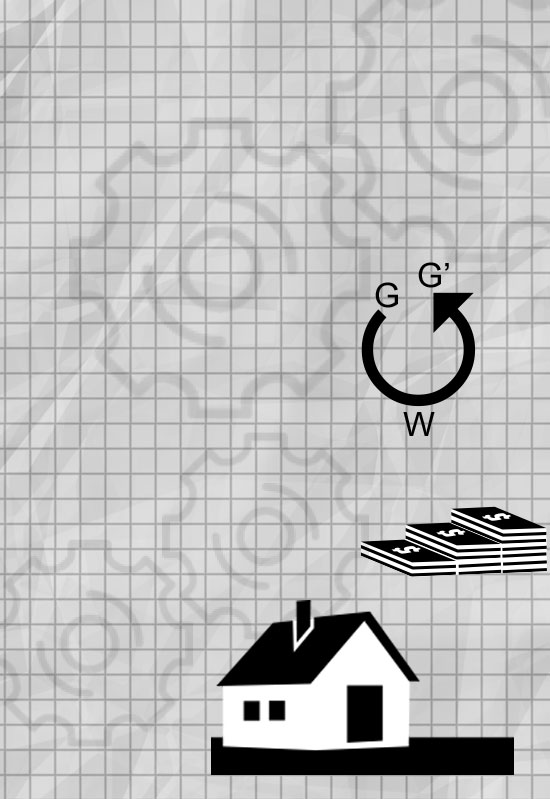Marx, Piketty und die grenzenlose Kapitalakkumulation
Kapital ist ein scheues Reh. Wie aber die Rudelbildung funktioniert, wusste Marx ebenso zu beschreiben wie Thomas Piketty in unseren Tagen. Ein Beitrag über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ökonomen.
2013 sorgte Thomas Piketty mit seinem Buch Das
Kapital im 21. Jahrhundert international für
Aufsehen. Darin legt der französische Ökonom
mittels einer detaillierten theoretischen
und empirischen Analyse dar, wie sich die
Verteilungen von Vermögen und Einkommen historisch
entwickelten. Ausschlaggebend für die erhaltene Resonanz dürfte aber
hauptsächlich sein Ausblick in das titelgebende 21. Jahrhundert sein:
Ohne vermögenspolitische Eingriffe werde die Vermögenskonzentration
aufgrund der Dynamik kapitalistischer Marktwirtschaften in den nächsten
Jahren und Jahrzehnten wieder deutlich ansteigen.
Dass Piketty diese Forschungsergebnisse unter dem
Titel Das Kapital im 21. Jahrhundert publizierte, ist
dabei alles andere als zufällig. Bereits Mitte des 19.
Jahrhunderts thematisierte Karl Marx in seinem Hauptwerk
Das Kapital eine Entwicklung, die Piketty als „die
zwangsläufige Tendenz des Kapitals, sich ohne natürliche Grenze zu akkumulieren
und zu konzentrieren“, beschreibt. Damit kritisierte Marx die mit
der Industrialisierung sprunghaft ausgeweitete Kluft zwischen Arm und
Reich, zwischen Industrieproletariat und Produktionsmitteleigentümern.
Sowohl bei Marx als auch bei Piketty scheint also diese Tendenz zur
grenzenlosen Kapitalakkumulation eine entscheidende Rolle einzunehmen.
Doch wie erklären sie sich diese kapitalistische Dynamik? Vor dem
Hintergrund der gerade durch Piketty erneut aufkeimenden Verteilungsdebatte
und anlässlich des diesjährigen Marx-Jubiläums werden hier die Theorien beider Ökonomen zur Kapitalakkumulation3 kurz
vorgestellt.
Nach Karl Marx entsteht Kapital durch die „Zirkulation des
Geldes“. In ihrer fundamentalen Form beginnt diese Zirkulation
damit, dass mit investiertem Geld (G) Waren (W) produziert
werden. Diese werden anschließend für mehr Geld (G‘) – dem
ursprünglichen Geldwert zuzüglich eines sogenannten Mehrwerts
– verkauft. So investiert ein Unternehmer beispielsweise
100 Euro, um eine Ware produzieren zu lassen, die er wiederum
für 120 Euro verkauft. Das sich in diesem Zirkulationsprozess vermehrende
Geld wird laut Marx zu Kapital – „die allgemeine Formel des
Kapitals“ ist also die Zirkulation G – W – G‘. Um jedoch Kapital zu bleiben,
müssen die Gelder weiter zirkulieren; die erzielten 120
Euro können wieder investiert werden. „Der Zirkulation
entzogen“, so Marx weiter, „ver- steinern sie zum Schatz“.
Allerdings ende diese Zirkulati- on des Geldes – entgegen der
Warenzirkulation – nicht mit einer Befriedigung ungestillter
Bedürfnisse. Vielmehr wird sie zum „Selbstzweck, denn die Verwertung
des Wertes existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten Bewegung.
Die Bewegung des Kapitals“, so Marx‘ Schlussfolgerung, „ist daher
maßlos.“
Damit ist jedoch noch nicht geklärt, wie Wert vermehrt bzw. geschaffen
wird. Marx ging dabei von der Auffassung aus, dass sich der Wert
einer Ware anhand der (gesellschaftlich durchschnittlichen) Arbeitszeit
bemisst, die für die Produktion dieser Ware aufgebracht werden muss.
Der Kapitalbesitzer ist zur Wertschöpfung also auf die menschliche Arbeit
angewiesen. Da die Arbeitszeit, die vom „freien Arbeiter auf dem
Warenmarkt“ angeboten wird, allerdings selbst Warencharakter annehme,
betont Marx, dass sich auch ihr Wert aus jener Arbeitszeit speise,
die für ihre Reproduktion, d.h. für den Lebensunterhalt des Arbeiters,
notwendig ist. Mit anderen Worten: Damit der Arbeiter seine Arbeit
reproduzieren kann, müssen geleistete Arbeitszeit
und erhaltene Entlohnung dem Wert der für den
Lebensunterhalt notwendigen Warensumme entsprechen.
Marx kritisiert jedoch, dass die faktisch
geleistete Arbeitszeit meist höher sei als die zur
Reproduktion notwendige, ohne dass diese Mehrarbeit
entsprechend entlohnt werde. Während also
gerade das Industrieproletariat zu dieser unbezahlten
Mehrarbeit gezwungen werde,
können die Kapitalisten den durch
die Arbeit geschaffenen Mehrwert
vollständig absorbieren. Die Ausbeutung des Proletariats,
so Marx, treibt also die Kapitalakkumulation zugunsten
der Geldbesitzer an. Somit sei es nur eine Frage der Zeit,
bis sich die Kapitalisten durch die unbegrenzte Akkumulation
selbst kannibalisieren oder die Arbeiter ob ihrer Ausbeutung
aufbegehren.
Eineinhalb Jahrhunderte später steht auch Thomas Piketty
vor der Frage, weshalb die Reichen (wieder) immer reicher werden. Im Vergleich zur Marx’schen
Arbeitswerttheorie geht Piketty in seiner
Analyse der Kapital- akkumulation allerdings
von deutlich offeneren Definitionen aus. Zum
Beispiel versteht er Kapital einfach als Synonym
für Vermögen. Für ihn beinhaltet der
Kapitalbegriff „alle Vermögensarten, die
Menschen (oder Gruppen von Menschen)
gehören und von ihnen weitergegeben oder dauerhaft auf
einem Markt getauscht werden können“. Neben Produktionsmaschinen
sind also auch Patente, Wertpapiere oder
das Eigenheim Formen von Kapital. Mit diesem weiten Konzept stellt
Piketty in einer empirischen Analyse der Entwicklung der Vermögensungleichheit
zunächst fest, dass die Vermögenskonzentration in den
von ihm detailliert untersuchten Nationen Frankreich, Großbritannien,
Schweden und den USA bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
ständig stieg und auf einem extrem hohen Niveau lag. So besaßen z.B.
die reichsten 10% der Franzosen allein 90% der nationalen Vermögenswerte. Aufgrund der Weltkriege und der wohlfahrtsstaatlich
ausgerichteten Nachkriegszeit (vor allem durch hohe
Spitzensteuersätze in der Einkommensteuer) nahm die Vermögensungleichheit
zunächst über Jahrzehnte deutlich ab; bis 1970 schrumpfte
der Anteil der reichsten 10% in Frankreich z.B. auf gut 60%. Erst seit
etwa den 1980ern steigt die Vermögenskonzentration in den
Industrieländern wieder an.
Diese Entwicklungen werden laut Piketty von der „grundlegenden
divergenzfördernden Kraft“ des Kapitalismus, der
Ungleichung „r > g“, vorangetrieben: Die Kapitalrendite „r“ liege langfristig
über der Wachstumsrate des Volkseinkommens „g“. Die Vermögen
wachsen also im Durchschnitt schneller als die Erwerbseinkommen.
Zugleich sind die Renditen hoher Vermögen größer als die der kleinen.
Wenn die großen Vermögen wie im vergangenen Jahrhundert nicht
durch kriegsbedingte Schäden zerstört oder durch hohe Steuern belastet
werden, käme es deshalb zu mehr Vermögensungleichheit, wie seit den
1980er wieder zu beobachten sei. Unreguliert, so Pikettys düsterer Ausblick,
könnte die Vermögenskonzentration also wieder die sehr hohen
Werte aus dem 19. Jahrhundert erreichen und so zu einer Gefahr für die
„demokratische Moderne“ werden.
Mit ihrer Analyse der Tendenz des Kapitalismus zur Kapitalakkumulation
und Vermögenskonzentration erzeugten
Marx und Piketty eine enorme Resonanz, die sich teils auch
in heftigen kritischen Gegenreaktionen zeigte. So wurde beispielsweise
darauf hingewiesen, dass die Marx’sche Arbeitswerttheorie, in der die Wertvermehrung
ja nur durch menschliche Arbeit möglich
sei, nicht erkläre, weshalb auch stark automatisierte
Branchen – man denke an die Automobil- industrie – große Wertzuwächse
verbuchen konnten. An Pikettys Analyse dagegen wird öfters die
Annahme einer hohen, die Wachstumsrate übersteigenden Kapitalrendite
kritisiert. So betont der amerikanische Ökonom Matthew Rognlie4,
dass nicht alle Kapitalarten, sondern hauptsächlich Immobilienvermögen
durch eine hohe Kapitalrendite ständig wachsen. Ein Hinweis, der
mit Blick auf die aktuell äußerst angespannten Wohnungsmärkte auch
in deutschen Ballungszentren einige Sprengkraft hat.
Trotz solcher Kritik lohnt jedoch die Lektüre der beiden „Kapital-Monographien“.
Während das Marx’sche Werk die Grundstrukturen des prozesshaften,
ständig zirkulierenden Wirtschaftens skizziert, legt Pikettys
Buch nahe, dass ein durch hohe Steuern und geschickte Regulierungen
„sozial temperierter Kapitalismus“ (Götz Briefs) keine extremen Ungleichheiten
produzieren muss.