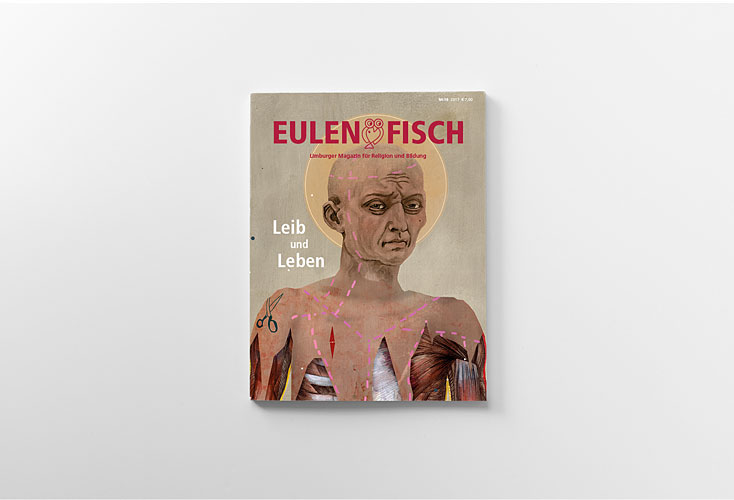Die Einverleibung des Singulars
Jesus, seinen Leib, essen – was sollte das? Er war soeben gestorben. Man hatte ihn gekreuzigt und begraben. Aber vorher hatte er dieses „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ befohlen, befohlen ihn zu essen, sich ein Brot einzuverleiben.
Das Emmaus-Intermezzo
Die Hinrichtung Jesu muss zunächst für diejenigen, die auf ihn alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, eine niederschmetternde und katastrophale Perspektive aufgerissen haben. Da hatte einer ein mitreißendes Beispiel dafür geliefert, dass der Gottesgeist in einem Menschen anwesend sein und wirken kann. Wie souverän war er doch mit der Heiligen Schrift umgegangen! Sein Finger hatte auf dem Tempelboden die Schrift zerschrieben, nach deren Buchstaben die Ehebrecherin hätte gesteinigt werden müssen. In seinen Gleichnissen vom verlorenen Sohn oder den Arbeitern im Weinberg hatte er die Aufhebung der gerechneten Gerechtigkeit gepredigt. Bei ihm kam die göttliche Gerechtigkeit ohne Rechnung aus. Auch dass der Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt gesprengt und dem Schläger die andere Wange hingehalten werden soll. Zu den Kranken, die ihn nur anfassen mussten, um geheilt zu werden, hatte er immer gesprochen: „Dein Glaube hat dir geholfen“. Indem er aus einer ansteckenden Nähe zu JHWH, den er als seinen Vater anredete, genauso handelte wie er auch lehrte, hatte er vorgelebt, wie Gottespräsenz im Menschenfleisch möglich war. Und nun wäre alles aus?
Auch für unsere Mediengeschichte des Monotheis-
mus wäre hier der Absturz ernsthaft zu befürchten gewesen. Dann hätte sich die Inkarnation, das Wort, das Fleisch geworden war, auf die Lebenszeit Jesu beschränkt. Dann wäre über eine interessante, aber womöglich folgenlose Episode von 33 Jahren zu reden gewesen. Ein faszinierender Prophet hätte uns vielleicht beeindruckt, Jesus, ein Held der Ideengeschichte – immerhin, mehr aber nicht.
So tritt am Tag danach der Ernstfall der Christologie ein. Mit der Erzählung vom Brotbrechen in Emmaus lässt Lukas den Erkenntnisprozess beginnen, der Jesus als den Christus zum Vorschein bringen und ihn aus der Kontingenz seiner 33 Jahre herausheben sollte. In dieser Episode wird die Alternative, das endgültige Scheitern, wie eine Kontrastfolie zunächst einmal dramatisch entfaltet. Alles war aus. „Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde“ (Lk 24,21). Das mussten die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus denken. Das mussten eigentlich alle Jünger gedacht haben.
Dann aber das Brot! Es war das Brotbrechen, das den Erkenntnisblitz auslöste: „Da gingen ihnen die Augen auf!“. Am Brotbrechen hatten sie schließlich Jesus erkannt. Also mussten sie von seiner Identifikation mit dem Brot und seinem Gedächtnisauftrag wissen, sonst hätten sie ihn an diesem Ritual nicht wiedererkennen können. Dass es zwei von den Zwölfen waren, wäre, so gesehen, nicht unplausibel, plausibel wäre andererseits aber nicht, dass sie ihn nicht schon unterwegs erkannt hatten. „Sie waren wie mit Blindheit geschlagen“. Außerdem heißt einer der beiden Kleopas. So hieß keiner von den Zwölfen (24,18). Wir sehen, diese Geschichte gehört nicht zu denen, die plausibel sein müssen. Sie fängt zwar sehr realistisch an, es ist aber eine Wundergeschichte.
An ihr ist viel zu lernen. Für einen Moment der Niedergeschlagenheit wird die Situation ausgemalt, die nicht nur für die beiden Jünger, sondern für alle eingetreten wäre, hätte es nicht das Brotbrechen gegeben, an dem sie ihn als den Auferstandenen hatten erkennen können. Kaum aber war das Brot gebrochen, „...sahen sie ihn nicht mehr“. Nun erst beginnt der eigentliche Erkenntnisprozess. Nun kam es darauf an, ihn, den man nicht mehr sehen konnte, gleichwohl als abwesend-Anwesenden zu begreifen. Den geheimnisvollen Begleiter hatten sie gebeten: „Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt“ (24,29). War er nun doch nicht geblieben? Kaum erkannt, schon entschwunden? Oder war er doch geblieben? Er war nicht mehr da, aber dennoch auf andere Art präsent. Vielleicht war er im Erkennen verschwunden. Was wäre das für eine Erkenntnis gewesen, wenn er als der verschwunden Anwesende erkannt worden wäre, übergegangen in das gebrochene Brot?
Wieder einmal wird uns eine Lehrperformance geboten! Wieder einmal lässt ein Erzähler Fakten sprechen, wieder einmal treffen wir auf eine Urszene des Monotheismus mit der für ihn so charakteristischen Simultaneität von Anwesenheit und Vorenthaltung. Es ist die Gründungserzählung für alle künftigen Abendmahlsfeiern. „Brotbrechen“, das war der Terminus, der in den frühen Gemeinden das Gedächtnismahl bezeichnete (Apg 2,42).
Die Vorstellung, den abwesenden Jesus dadurch präsent zu halten, dass man sich jenes Brot einverleibt, über das er diese Das-ist-mein-Leib-Formel gesprochen hatte, ist gewiss ein Mysterium. Dass die Formel bewirkt, was sie behauptet, musste man ihm glauben. Sie entbehrt aber nicht einer medienpolitischen Konsequenz. In ihr geht es um nichts weniger als darum, jene Verbindung des Gottesgeistes mit dem Menschenfleisch, das Modell der Inkarnation, die in Jesus manifest geworden war, über seinen Tod hinaus zu retten.
Dass Gott der Andere und Einzige, dass niemand anderer als JHWH, die große Singularität, das große Gegenüber des Ganzen, dass Gott in einem Menschen anwesend sein könnte, diese Vorstellung war den einen blasphemisch vorgekommen („Er hat Gott gelästert.“ Mk 14,64; Joh 19,7), für die anderen war sie die begeisternde Offenbarung eines Modells, das mit Jesu Tod einfach nicht verschwunden sein durfte.
Wer den Leib Jesu in seinen Körper aufnimmt, lässt ihn nach innen vordringen, dorthin, wo das Herz ist. ‚Leib’ und Leib kommen da zusammen.
Wer den Gedächtnisauftrag ausführte, wer also das ungesäuerte Brot, den „Leib Jesu“, sich einverleibte, hätte, sooft er dies täte, Anteil an dessen Gottespräsenz. Das wäre dann der Ernstfall unseres Satzes aus dem Johannesprolog: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden...“ (1,12).
Den souveränen Umgang mit Gegenwart und Vergangenheit hatte die jüdische Tradition schon als rituelle Zeitvernichtung eingeübt. Da war dieses ungesäuerte Brot aus dem Exodus, jener sagenhaften Rettungstat, mit der JHWH Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreite. Dieses Brot hatte sich inzwischen als ein Mittel für einen besonderen Umgang mit der Zeit bewährt. Ihm wurde ein siebentägiges Fest gewidmet, das „Fest der ungesäuerten Brote“. In diesen Tagen wanderte Israel jedes Jahr von neuem in Gedanken durch die Wüste und aß das Wüstenbrot der Befreiung. Der Seder-Abend bildete dann den Höhepunkt und Abschluss des Pascha-Festes, die Inszenierung des plötzlichen Aufbruchs. Dann waren alle, die ganze Tischgemeinschaft, einen Abend lang, „…das ist heute“, die Kinder Israels, die sich die Lenden gürteten, um in die Wüste zu ziehen.
Was war das für eine Präsenz, die da aus der Tiefe der Erzählung heraufgerufen wurde? Sie konnte nur kurz aufblitzen, denn es war die Präsenz des Pessach, das heißt eines Vorübergangs, eines flüchtigen Moments, in dem sich einst Zeit und Ewigkeit berührt hatten. Wie sich die Modalitäten der Zeit verschränken – flüchtig und zugleich aufgehoben! Der Kult der Erinnerung war eingelassen in den wiederkehrenden Takt des Jahreskreises. Hier regierte die unaufhaltsame Normalzeit, die bei aller Beschwörung ihrer Abwesenheit am Ende keinen Ausbruch zuließ. Unmöglich, Präsenz auf Dauer zu stellen. Was wäre denn das – eine Präsenz, die dauern könnte? Ihr innerer Widerspruch hätte sie, kaum ausgerufen, in nichts aufgelöst. Auf dem Berg der Verklärung Jesu hatte Petrus den Vorschlag gemacht, die Zeit anzuhalten („Hier ist gut sein…“ Mk 9,5) und drei Hütten zu bauen. Die glanzvoll-zeitlose Gegenwart des Verklärten, flankiert von Mose und Elia, sollte dauern – mit festem Wohnsitz. Den Wunsch kann man sogar verstehen. Zum Topos des erfüllten Augenblicks gehört regelmäßig auch der Wunsch, ihn festzuhalten: „Verweile doch, du bist so schön!“ Aber welcher Augenblick hätte je diese Bitte erfüllt? Die Pointe dieses Wunsches besteht jedes Mal in seiner Unerfüllbarkeit. Daran konnte auch Mephisto nichts ändern. Es bleibt dabei: Keine Hütten auf dem Berg der Verklärung!
Der zweite Teil des großen Satzes vom Wort, das Fleisch geworden ist (Joh 1,14), lautet: „…und hat unter uns gezeltet“ („eskénesen“). Oft übersetzt mit: „…und hat unter uns gewohnt“. In dem Bild vom Zelt kommt sehr treffend der passagere Charakter jeder inkarnatorischen Präsenz zum Ausdruck. Ein Zelt ist nichts für die Dauer. Schnell ist es auf-, schnell aber auch wieder abgeschlagen; Jesus hatte keinen festen Wohnsitz (Vgl. Mt 8,20).
Die Riten, mit denen Israel alljährlich am Pessachfest so tut, als sei die verstrichene Zeit aufgehoben, erzeugen den für seine Gedächtniskultur so charakteristischen Umgang mit der Zeit. In jenem „Das ist heute!“, das am Sederabend ausgerufen wird, hört es ein Echo aus dem Hintergrund der Zeit. Der Ritus, der das Einst zum Heute macht, erzeugt allererst das Bewusstsein von Zeit und einen Sehnsuchtsblick durch die Gitterstäbe des Zeitkäfigs. Gerd Neuhaus erkennt im Exodus-Narrativ, dem Auslöser dieser Riten, eine „identitätsstiftende Urerfahrung“, die den Hintergrund dafür aufspannt, was für Israel überhaupt eine Erfahrung sein kann, so dass das Exodus-Geschehen mit jeder weiteren Erfahrung gleichzeitig wird: Ein Jude ist seitdem einer, den Gott aus dem Sklavenhaus befreit hat.
Immer wieder begegnet in der Bibel diese Vorstellung einer passageren Gegenwart, so, als ob der Ewigkeit, das heißt der aufgehobenen Zeit, ein Platzhalter in einer Wirklichkeit verschafft werden könnte, die aus ihrer Zeitkoordinate ansonsten nicht herauskann. Der größte dieser Platzhalter war das Allerheiligste Israels, der genial singuläre „Name“, die Offenbarung aus jenem Dornbusch ohne Zeit, der brannte und nicht verbrannte. Das „Ich bin der ,Ich bin da‘“ war aus dem Jenseits der Zeit hereingerufen, um in ihr zu wirken.
Arbeit an der Zeit
Zu einem solchen Platzhalter war auch das ungesäuerte Brot aus dem Exodus geworden. Seine in vielen Pessach-Feiern bewährte Kraft, eine Gegenwart des Vorübergangs aufzurufen, muss Jesus bewogen haben, auch seine künftige Gegenwart immer neu für einen Augenblick des Vorübergangs zu ermöglichen. Künftige Gegenwart – darum musste es ihm angesichts des nahen Todes zu tun sein. Um himmlisches „überwesentliches“ (epioúsion) Brot für die Gegenwart eines jeden neuen Tages zu bitten, hatte er seine Jünger schon früher gelehrt. In Verlängerung dieses allgemeinen Aggiornamentos im Vaterunser, das auch ohne die finale Zuspitzung des letzten Abendmahls von den Jüngern gebetet werden konnte, trat nun die Erfüllung des Gedächtnisauftrags: „Das ist mein Leib für euch“. Und: „tut dies zu meinem Gedächtnis“. Das ungesäuerte und damit alteritär markierte Brot, der alte Sinnträger, erstrahlte da in einer neuen Qualität. Das alte Exodus-Medium war nicht verworfen. Aus der Tiefe des Narrativs mit seiner Freiheit verheißenden Semantik leuchtete es, neu überschrieben, in seinem überbietenden Sinn. Wer dieses Brot, das zum Leib Jesu geworden war, dann aß, machte mit dieser Einverleibung sich selbst, seinen ganzen Körper zu einem neuen Medium.
Künftige Gegenwart – darum musste es Jesus angesichts des nahen Todes zu tun sein.
„Einverleibung“ hat sonst einen Beiklang von Unrechtmäßigkeit, der hier nicht passt. Diesmal ist das Wort fast technisch gemeint. Niemand wird gefressen, aber wenn das Brot, das da gegessen wird, der Leib Jesu ist, geht ein Leib in einen anderen ein. Beide vereinigen sich und werden eins. Was kann das medien-
theoretisch bedeuten?
Das Innen-Außen-Verhältnis des Körpers ist uns in dieser Mediengeschichte schon mehrfach begegnet. Über die Lippen, diese undichte Stelle des Körpers, waren sonst Wörter nach außen entflohen, die, wie wir bei Homer gelernt haben, einmal nach außen gelangt, nie mehr eingefangen werden können. Diesmal ist es umgekehrt. Aus dem Körper tritt nichts heraus, er empfängt etwas von außen. Der singuläre Sinnträger, das ungesäuerte Brot, gelangt ins Innerste. In dieser Zusammenführung des Leibes Jesu mit dem, der ihn isst, wäre eine Differenz verschwunden, die sonst trivialerweise für alle Medien gilt. Adorno hatte beklagt, dass, jedes Mal wenn ein Mensch Medien produziert, also Wörter oder Bilder in die Welt setzt, sich etwas verselbständigt und sich ein Objekt vor den Gedanken schiebt, der sich dann von einem Begriff oder Bild vertreten lassen muss: „Bewußtsein, das zwischen sich und das, was es denkt, ein Drittes, Bilder schöbe, reproduzierte unvermerkt den Idealismus…“2. Ins Grundsätzliche gewendet, gälte das auch für Begriffe. Mit leisem Spott könnte man dieses „Bilderverbot“ als Pose abtun: Anders geht es nun mal nicht!
Oder doch? Im Ritual des Jesus-Essens geht es um die Idee, dass der Geist Gottes und Menschenfleisch zusammenfinden könnten, ohne dass etwas dazwischenträte. Das war doch die Kernbotschaft der Inkarnation gewesen: Hier, in Jesus, war doch nach Johannes 1,14 das Wort Fleisch geworden, das Wort, das vor aller Zeit „im Anfang“ war, das Wort, durch das alles geworden war, was geworden ist – das Wort, das Gott war (Joh 1,1–3). Dass das Wort nicht, wie sonst immer, Schrift, sondern Fleisch geworden war, das war doch das medientheoretisch sensationell Neue gewesen. Wer in Jesus die Anwesenheit des Gottesgeistes erlebt hatte, musste an diesem Modell festhalten. Indem Jesus sich selber essbar machte, hatte er dafür den Weg eröffnet. Wer diesen Leib Jesu nun in sich aufnahm, hätte die Inkarnation in sich hinein verlängert, sich selbst zum Gottesmedium gemacht.
Ein Klassenunterschied
Medientheoretisch tritt hier ein entscheidender Klassenunterschied zutage, der zwischen Medium-Sein und Medien-Haben. Über Gott könnte man weiterhin, so wie über alles andere auch, reden, vielleicht sogar Bilder machen, wenn denn seine Andersartigkeit in ihnen markiert wäre. Das wäre aber von dem, was in großer Einmaligkeit hier geschähe, deutlich zu unterscheiden. Und weil es diesen Klassenunterschied gibt, kann ein Mensch, der sich selbst als Medium begreift, zum Meta-Medium werden. Diese Erkenntnis macht ihn zur Agentur von Differenz. Sie setzt ihn in den Stand, sich zur maßgebenden Instanz für alle Medien zu machen, die er sonst erzeugt und mit denen er umgeht. Einfacher gesagt, er kann es machen wie Jesus mit der Heiligen Schrift.
Das wäre wahrlich kein geringer Nebeneffekt: Einer, der sich selbst als Medium begreift, kann eine besondere Empfindsamkeit für die Risiken ausbilden, die mit jedem Einsatz von Medien durch ihre zwangsläufige Verselbständigung entstehen. Wenn das der Grund für Adornos Empfindsamkeit war, leisten wir bei ihm Abbitte.
Die Idee eines Bewusstseins, das, ganz unverstellt durch ein dazwischentretendes Medium, ganz bei sich und ganz bei den Sachen wäre, hat etwas Faszinierendes, wenn ihr auch, streng genommen, nichts entsprechen kann, denn sobald sie sich artikuliert und den Körper verlässt, geriete sie in einen performativen Selbstwiderspruch. Als Idee aber liefert sie den strengsten Maßstab, an dem sich alle Objektivationen messen lassen. So ist das nun mal mit den Ideen, sie sind fleischlos, aber wirksam. Einen Körper aber braucht jedes Bewusstsein. Und vom Körper als dem Ursprung und Ziel aller medialen Hervorbringungen eine Vorstellung zu haben, macht ihn zu einem Widerlager der Kritik. Von hier aus erschließt sich das Potential der Inkarnation. Wenn das neutestamentliche eucharistische Narrativ das Brot des Gedächtnismahls, den Leib Jesu, zu einem Realsymbol erklärt, macht es ihn zum Medium einer metamedialen Singularität. Sie ist, was sie bedeutet. Der Körper des Christen, der den Leib Christi in sich aufgenommen hat, weiß um die Andersartigkeit und Einzigkeit dieses Gottesmediums. Die vereinigten Körper sind zu allen anderen Medien auf Abstand gegangen. Dadurch verschaffen sie der Medienkritik einen reflexiven Referenzpunkt. Hat dieser etwa eine Strukturgleichheit mit dem Referenzpunkt der Reflexion, als den wir JHWH, den Gott Israels, das große Gegenüber und den Schöpfer der Welt, ausgemacht haben?
Wer den Leib Jesu in seinen Körper aufnimmt, lässt ihn nach innen vordringen, dorthin, wo das Herz ist. „Leib“ und Leib kommen da zusammen. Das Medium Brot, Realsymbol des großen Singulars, ist im Menschen, dem Metamedium der Inkarnation angekommen. Dieser Vorgang, wenn man ihn in die Konsequenz treibt, muss auch deshalb Einzigartigkeit beanspruchen, weil es der Geist JHWHs des Einzigen war, der in Jesus passager, das heißt vorübergehend, sein Zelt aufgeschlagen hatte. In der Einverleibung Jesu, des Fleisch gewordenen ewigen Wortes, kommt der Einzige zum Einzigen, als welcher sich jeder vorkommen muss, der das Brot isst. „Gott in meinem Körper“ – wäre das nicht die Antwort auf das Drama meiner Endlichkeit?“ Der Evangelist Johannes jedenfalls sah es so. Er lässt Jesus sprechen: „Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit (6,58)“ .