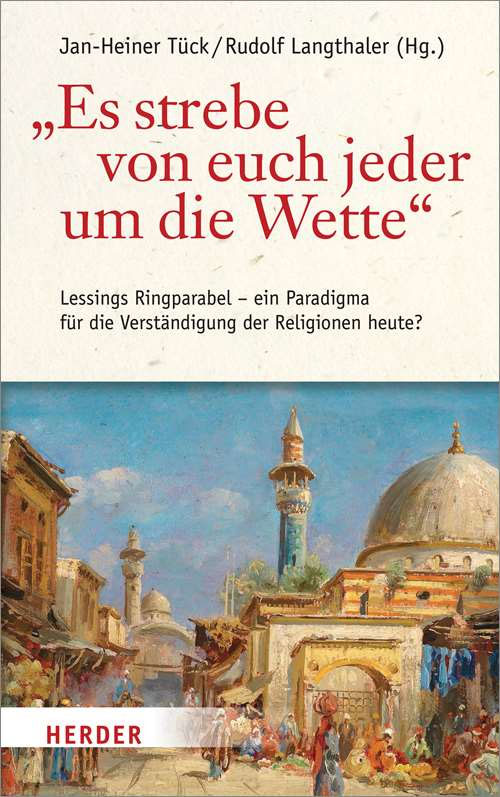
Bestellen
auf Buch7.de - sozialer Buchhandel
Jan-Heiner Tück / Rudolf Langthaler (Hg.): „Es strebe von euch jeder um die Wette.“
Lessings Ringparabel – ein Paradigma für die Verständigung der Religionen heute?
Auf den ersten Blick scheint der vorliegende Sammelband nicht zu halten, was sein Untertitel verspricht. Denn nur ein Teil seiner Beiträge setzt sich mit der Aktualität der Ringparabel auseinander. Etliche Aufsätze leuchten ihre Vorgeschichte oder ihren geschichtlichen Kontext in Leben und Werk Lessings aus, und insbesondere zeigt in diesem Zusammenhang W.A. Euler, welche Ansätze zur Würdigung anderer Religionen schon die christliche Theologie des Mittelalters hervorgebracht hat. Auf diese Weise wird es freilich erst möglich, den spezifischen religionstheologischen Beitrag zu würdigen, den Lessing selber zur Konkurrenz religiöser Wahrheitsansprüche liefert. Dieser besteht zunächst einmal in der Forderung, in dieser Weltzeit die Frage nach der wahren Religion offenzulassen und stattdessen ein überprüfbares pragmatisches Geltungskriterium zu formulieren: Eine Religion kann in dem Maße Wahrheit beanspruchen, wie es ihr gelingt, in der Verfolgung ihres – an sich selbst nicht überprüfbaren – Wahrheitsanspruchs bestimmte Humanitätspotentiale zu verwirklichen.
In dieser pragmatisch-funktionalen Wendung der Wahrheitsfrage erkennt J. Assmann in seinem einleitenden Beitrag die bleibende Aktualität der Ringparabel. Damit bleibt er seiner Einschätzung exklusiver religiöser Wahrheitsansprüche treu, die er erstmals in „Die mosaische Unterscheidung“ vorgelegt hat und für die Lessings „Nathan“ einen beispielhaften Beleg liefert. Dort sagt nämlich Recha über die Christen, sie müssten in Kenntnis des einzigen Heilsweges „ aus Liebe quälen“ und notfalls unter Einsatz von Gewalt und gegen deren Willen Andersgläubige auf besagten Weg zwingen. Demgegenüber erkennt Assmann in der Ringparabel im Spruch des Richters die an jede Religion gerichtete Aufforderung, ihren Glauben stets nur so zu artikulieren, „als ob“ er der wahre wäre.
Freilich bleibt ein solcher Ratschlag in der Überlegenheitsgebärde des Therapeuten, der seinem Patienten ein Placebo verordnet, das seine nachweisbare Wirksamkeit nur dadurch entfaltet, dass er ihm die Aufklärung über „die geheime Kraft“ dieses Medikaments vorenthält. Sobald er ihn nämlich in das Geheimnis seiner Wirksamkeit einweiht und ihn auffordert, mit dem Medikament so zu verfahren, „als ob“ es wirkliche Heilkräfte enthalte, verliert es seine Wirksamkeit. Insofern hält sich Assmanns Forderung in einer – religionsphilosophisch freilich legitimen – Außenperspektive auf, von der J.H. Tück in seinen beiden Beiträgen mit Recht feststellt, dass sie innenperspektivisch eine nicht einlösbare Zumutung für den jeweiligen Gläubigen darstelle. In der innenperspektivischen Umsetzung von Lessings Toleranzforderung gelte es vielmehr, diejenigen Toleranzpotentiale freizulegen, welche die jeweilige religiöse Tradition in der Verfolgung ihres spezifischen Wahrheitsanspruchs von sich aus bereithalte. Diese erkennt er im Christentum in der Haltung eines „reflexiven Inklusivismus“. Damit meint er nicht die Vulgärgestalt, mit der Vertreter einer pluralistischen Religionstheologie den Inklusivismus als Strategie einer Vereinnahmung kritisieren, die in anderen Religionen bestenfalls die verdunkelte Gestalt einer Wahrheit erkennt, über die man selber zu verfügen meint. Vielmehr versteht er den Begriff eines religiösen Wahrheitsanspruchs grammatisch als „genitivus subiectivus“: als Bewusstsein einer Wahrheit, über die nicht ich verfüge, sondern von der ich mich in Anspruch genommen weiß. Wenn diese Wahrheit menschlicherseits jedoch unverfügbar ist, dann kann ich als Christ nicht ausschließen, dass mir in anderen Religionen Momente einer Wahrheit begegnen, die von mir noch reflex angeeignet werden wollen und mich zu einem vertieften Verständnis dessen führen, was in Jesus Christus geschehen ist. Zur Unterstützung dieser Position sei angemerkt: Laut „Nostra aetate“ erkennt die Kirche in fremden Religionen keine Abweichungen von der Wahrheit, sondern „von dem […], was sie selber für wahr hält und lehrt“. Darin liegt eine Selbstrelativierung der kirchlichen Glaubensgestalt gegenüber dem in Jesus Christus gegebenen Wahrheitsgeschehen.
Über welche Ansätze zur Toleranz gegenüber anderen Religionen der Islam in dieser Hinsicht verfügt, zeigen die Beiträge von A.M. Karimi sowie von K.-J. Kuschel. Letzterer liefert nicht nur eine exzellente Analyse zur Handlungs- und Problemstruktur des „Nathan“, sondern stellt aus der islamischen Tradition auch das „Perlengleichnis“ sowie das „Gleichnis vom Skeptiker“ vor. Deren Ethos begegnet in der Sure 5,48 des Korans mit der Forderung nach einem Wettstreit im Guten.
Aus jüdischer Perspektive merkt allerdings M. Brumlik an, schon Lessings Freund Moses Mendelssohn habe diesem gegenüber die Sorge geäußert, dass dessen Konstruktion einer Vernunftreligion zur Quelle neuer Intoleranz gegenüber den Offenbarungsreligionen werden könne. Denn alle Beiträge dieses Bandes sind sich darin einig, dass für Lessing Offenbarung nur eine katalysatorische Funktion bei der Entdeckung von Vernunftwahrheiten habe. Freilich hätte hier der Paragraph 93 von Lessings „Erziehung des Menschengeschlechts“ stärker berücksichtigt werden können. Hier stellt Lessing nämlich fest, dass die Offenbarungsreligionen nicht nur menschheitsgeschichtlich, sondern auch individualgeschichtlich – und damit stets von Neuem – die besagte katalysatorische Funktion gewinnen.
Dass die Offenbarungsreligion für Lessing mehr ist als ein Vehikel, das der Mensch – einmal zur Vernunft gelangt – von sich abstoßen kann, zeigt die siebte Szene des vierten Aktes im „Nathan“, auf die keiner der vorliegenden Beiträge eingeht, auf deren Bedeutung aber Ingrid Strohschneider-Kohrs – die 2014 verstorbene „grande dame“ der Lessing-Forschung – aufmerksam machte: Als Nathan dem Klosterbruder erzählt, dass Christen bei einem Pogrom seine Frau und seine sieben Söhne umgebracht hatten, handelt es sich um eine Erfahrung, die ihm nach eigenem Bekunden die Vernunft geraubt hatte und in deren Verarbeitung der Glaube an Gott als ein vorreflexes Einverständnis mit dem Leben ihn wieder zur Vernunft brachte. Es gibt offensichtlich Erfahrungen, von denen ein Satz aus Lessings „Minna von Barnhelm“ Zeugnis ablegt, der als Aphorismus Karriere gemacht hat und der da lautet: „Wer über manche Dinge nicht den Verstand verliert, hat keinen zu verlieren.“ Dann aber ist das Verhältnis von Vernunft und Offenbarung von Lessing her offensichtlich differenzierter zu bestimmen, als Assmanns Deutung der Ringparabel nahelegt: Der Glaube vermag den Menschen auch dort noch zur Vernunft zu bringen, wo diese an einer Wirklichkeit zerbricht, die sich deren Ansprüchen nicht fügt.
Dass die Vernunft nicht nur das Humanitätspotential der Religionen freilegt, sondern diese ihrerseits das Aufklärungspotential der Vernunft noch einmal radikalisieren, zeigt ein bemerkenswerter Beitrag von H.D. Klein. Dieser macht zunächst – wie schon M. Brumlik – darauf aufmerksam, dass die Relativierung konkurrierender religiöser Wahrheitsansprüche zwangsläufig nur im Namen eines Absoluten geschehen kann, dessen Beanspruchung wiederum in diejenige Überlegenheitsgebärde zurückzufallen droht, die durch die Toleranzforderung der Ringparabel doch überwunden werden soll. Darum verweist Klein auf das spezifische Aufklärungspotential, das der Monotheismus gerade über sein Bilderverbot gewinnt und mit dem er den Aufklärungsanspruch der Vernunft in einer Weise fortsetzt, die diesen noch einmal radikalisiert. Damit verweist er im Ergebnis wieder auf die Bedeutung desjenigen Gedankens, den Tück in seinen beiden Beiträgen äußert: dass nicht die Vergleichgültigung, sondern die genannte Radikalisierung des religiösen Wahrheitsanspruchs die monotheistischen Religionen zu einem lernfähigen Umgang miteinander anleitet.
Freiburg: Herder-Verlag. 2016
327 Seiten
19,99 €
ISBN 978-3-451-34924-9

