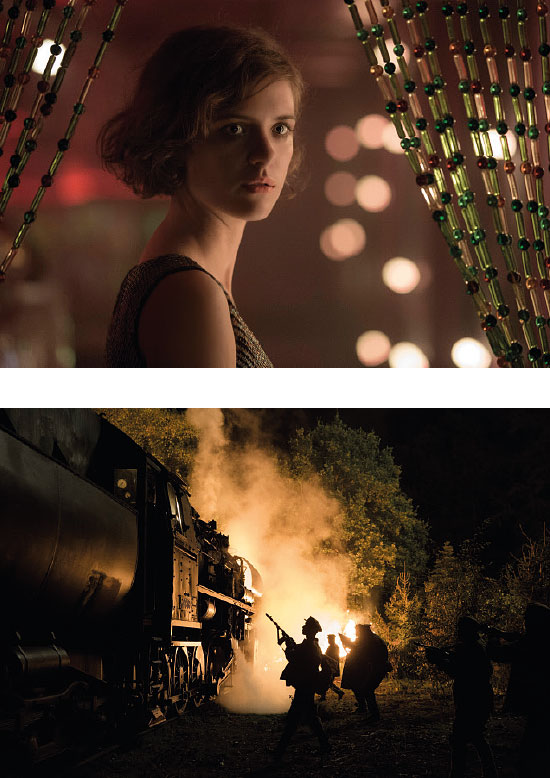Heilig oder profan?
Schon immer lockten Großstädte Glücksritter verführerisch mit ihren glänzenden Angeboten. Menschen suchen im Wirrwarr nach der Sinnhaftigkeit des Lebens. Gibt es einen Platz für das Heilige, lässt es sich im modernen Babylon noch finden?
Ein „Sonntagmorgen“ mit Mascha Kaléko
Die Straßen gähnen müde und verschlafen.
Wie ein Museum stumm ruht die Fabrik.
Ein Schupo träumt von einem Paragraphen.
Und irgendwo macht irgendwer Musik.
Die Straßenbahn fährt, als tät sie’s zum Vergnügen,
Und man fliegt aus, durch Wanderkluft verschönt.
Man tut, als müsste man den Zug noch kriegen.
Heut muß man nicht. – Doch man ist’s so gewöhnt.
Die Fenster der Geschäfte sind verriegelt
Und schlafen sich wie Menschenaugen aus. –
Die Sonntagskleider riechen frisch gebügelt.
Ein Duft von Rosenkohl durchzieht das Haus.
Man liest die wohlbeleibte Morgenzeitung
Und was der Ausverkauf ab morgen bringt.
Die Uhr tickt leis. – Es rauscht die Wasserleitung,
Wozu ein Mädchen schrill von Liebe singt.
Auf dem Balkon sitzt man, von Licht umflossen.
Ein Grammophon kräht einen Tango fern …
Man holt sich seine ersten Sommersprossen
Und fühlt sich wohl. – Das ist der Tag des Herrn!
„Sonntagmorgen“ wurde im Mai 1930 in der „Vossischen
Zeitung“ veröffentlicht. Damit meldete sich eine
Berliner Büroangestellte mit jüdisch-polnischen Wurzeln
erstmals öffentlich zu Wort. Mascha Kaléko, geborene
Engel, arbeitete seit 1924 im „Arbeiter-Fürsorgeamt
der jüdischen Organisationen Deutschlands“
in Berlin Mitte, dort, wo sich heute im Umkreis der
Oranienburger Straße wieder jüdisches Leben angesiedelt
hat.
„Acht Stunden bin ich dienstlich angestellt / Und
tue eine schlechtbezahlte Pflicht“, das schreibt die
Stenotypistin und „Tippse“, wie sich die witzig-melancholische
Lyrikerin selbst bezeichnet, in ihrem
1933 erschienenen Gedichtband „Das lyrische Stenogrammheft“.
Das Besondere, das in Mascha Kalékos
Gedichten Ausdruck gewinnt, sind ihre Themen: Hoffnung
und Liebe, Alltagsleben und Sonntagsexistenz,
aber auch das Heilige und das Profane.
Berlin zwischen Babel und Bibel
Stenotypistin ist auch Charlotte Ritter. Sie spielt eine
der Hauptrollen in der Erfolgsserie „Babylon Berlin“,
arbeitet für die Polizei und trägt als Protagonistin
wesentlich dazu bei, dass die Goldenen Zwanziger
Jahre gerade eine bemerkenswerte Auferstehung erleben.
In einer der ersten Szenen von „Babylon Ber-
KULTUR
VON HEILIGKEIT BERÜHRT 99 EULENFISCH
lin“ ist eine rasende Dampflokomotive zu sehen, die
an Walter Ruttmanns „Sinfonie der Großstadt“ von
1927 erinnert – mich aber zugleich an den Priester
Carl Sonnenschein (1876-1929) denken lässt, der es
mit dem heilig-profanen Berlin mutig aufnahm und
über die Ankunft in die Metropole notiert: „Dieser
ganze erste Tag war Traum, Wirrwarr, Babylon! Alles
erdrückend.“
Der umgetriebene Weltstadtapostel hält sich nicht
damit auf, Babel zu verteufeln, sondern nimmt die
Herkulesaufgabe in Angriff, sich um die Arbeiterheere
zu kümmern, die in die deutsche Hauptstadt ziehen.
In die 4,2 Millionen Einwohner zählende Großstadt
mit ihren rund 400.000 Katholiken strömten damals
aus den östlichen Landesteilen über den Schlesischen
Bahnhof – im Volksmund auch als Katholischer Bahnhof
verspottet – Unmengen von Zuwanderern. „West
und Ost als geokulturelle Pole waren sogar in die soziale
Topographie Berlins eingeschrieben. Die Gegend
um den Schlesischen Bahnhof war typisches Bahnhofsmilieu
mit Nachtlokalen, Bordellen und billigen
Hotels.“
Für die armseligen Gestalten, die das unansehnliche
Bahnhofs-Nadelöhr passieren müssen, fühlt sich
Sonnenschein verantwortlich. Da Berlin noch kein
eigenständiges Bistum ist, fehlen katholisch-caritative
Strukturen weitgehend. Der Seelsorger fragt nicht
nach dem Taufschein, sondern versucht, die größte
Not der Neu-Berliner in ihren Elendsquartieren im
Norden und Osten der Stadt – bestens bekannt durch
Zilles „Milljöh“-Studien – zu lindern.
Der bloße Anblick einer Kirche in der Silhouette der
Städte wird für den gehetzten Schriftsteller zum
tiefsten Ausdruck für die Sinnhaftigkeit des Lebens.
Um dem kaum zu
bewältigenden Elend die Stirn zu bieten, richtet der
Priester in der Georgenstraße 44 nahe dem Bahnhof
Berlin Friedrichstraße ein Büro ein. Dort suchen ihn
täglich 70 bis 80 Hilfebedürftige auf. „Er hielt Sprechstunden
manchmal von 9 Uhr morgens bis um Mitternacht,
wenn er nicht abends andere Verpflichtungen
hatte. Sein Raum: an der Wand
ein Stadtplan von Berlin, an den anderen drei
Wänden Regale mit Karteikästen. Er selbst
arbeitete – und aß auch oft – an einem Brett,
das über Karteikästen gelegt war. Daneben
Telefon und Klingeln. Das Palais des ‚Papstes
von Berlin’ nannten es die Kommunisten.
Zentrum 8659 war bald eine der wichtigsten
Nummern des katholischen Berlin, ebenso
wie seine Postschecknummer.“
Großstadt und Glückssuche
Ja, renn nur nach dem Glück / doch renne
nicht zu sehr! / Denn alle rennen nach dem
Glück / Das Glück rennt hinterher“4, konzentriert
Bertolt Brecht (1898-1956) seine Berliner
Erfahrungen in der „Ballade von der
Unzulänglichkeit menschlichen Planens“, die
1928 mit den Songs der „Dreigroschenoper“
uraufgeführt wird. Der religiöse Skeptiker
klingt dabei fast wie ein spiritueller Klassiker,
wenn er wie der Kirchenlehrer Augustinus
zu bedenken gibt: Glücksjagd und Suche
nach Seelenruhe bilden ein Leitthema großstädtischer
Existenz. Allerdings begnügt sich
der spöttische Stückeschreiber – anders als
der Gottsucher des vierten
Jahrhunderts – damit, sich
auf ein sehr irdisches Glück
zu konzentrieren.
Dem urbanen Intellektuellen
spätantiker Wendezeiten
winkt eine imperiale
Karriere im Ballungszentrum
der Macht: Glänzende
Verlockungen bleiben nicht aus, politischer
Einfluss, Ruhm als Redner und schneller
Genuss. Aber das bisschen „Unsterblichkeit“
taugt auf Dauer nicht dafür, seinen Durst
nach Glück zu stillen. Aurelius Augustinus,
der Verfasser der „Bekenntnisse“, gibt darum
gleich zu Beginn der ersten Autobiografie
der Weltliteratur zu bedenken: „und unruhig
ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir – et inquietum est cor nostrum donec requiescat
in te.“ „Denn für dieses Leben / ist der Mensch nicht
anspruchslos genug / Drum ist all sein Streben / nur
ein Selbstbetrug“, heißt es weiter in Brechts Ballade.
Das dem Menschen innewohnende Glücksverlangen
bleibt bei dem Anti-Illusionisten unerlöst.
Der Autor, mit dem Dickicht der Megacitys vertraut,
empfiehlt seinen Lesern im 1922 entstandenen autobiografischen
Gedicht „Vom Armen B.B.“ dagegen cool
zu bleiben und es mal mit einem Lob des Profanen zu
versuchen: „In der Asphaltstadt bin ich daheim. Von
allem Anfang / Versehen mit jedem Sterbesakrament:
/ Mit Zeitungen. Und Tabak. Und Branntwein. / Mißtrauisch
und faul und zufrieden am End“. Aber hörbar
werden bei dem radikalen Entromatisierer am Ende
auch Töne, die ängstlich und sehnsuchtsvoll klingen:
„Bei den Erdbeben, die kommen werden, werde ich
hoffentlich / Meine Virginia nicht ausgehen lassen
durch Bitterkeit / Ich, Bertolt Brecht, in die Asphaltstädte
verschlagen / Aus den schwarzen Wäldern in
meiner Mutter in früher Zeit.“ Aber bloß keine Ergriffenheit
und kein Mitleiden zeigen, sondern Distanz
und Spott für das ganze Brimborium.
Für Brechts zwiespältige Verheißungen, die stark
nach billigem Branntwein riechen, ist der Sinnsucher
Alfred Döblin (1878-1957) nicht zu begeistern. Dagegen
erlebt der angehende Schriftsteller schon früh
eine einschneidende Begegnung mit dem Religionsverächter
Friedrich Nietzsche. Was war geschehen?
Döblin selbst berichtet von diesem dramatischen
Ereignis: „Ich erinnere mich, wie ich im Zimmer sitze
und nach der Lektüre der ‚Genealogie der Moral’ das Buch schließe, beiseitelege und mit einem Heft
bedecke, buchstäblich zitternd, fröstelnd, und wie ich
aufstehe, außer mir, im Zimmer auf und ab gehe, und
am Ofen stehe. Ich wußte nicht, was mir geschah, was
man mir hier antat. Kannte ich Gott, trotz alledem?
Gott, gegen den es hier ging? Wußte ich von ihm? Ahnte
und ersehnte ich ihn? Ich weiß nicht. Aber ich sah,
daß es hier schrecklich ernst wurde, daß es um Gott
ging und daß ich daran beteiligt war“, berichtet der
Autor in seiner „Schicksalsreise“8. „Ich hatte schon
schwere Dinge erlebt und mochte den Spaß der gutsituierten
Leute nicht (…) Und da kam Nietzsche, er
hatte nicht Medizin studiert und wußte auch nicht
viel von Naturwissenschaften, aber mit dem, was er
wußte und hatte, verstand er umzugehen.“
Die von Döblin in „Berlin Alexanderplatz“ anhand
der Figur Franz Biberkopf beschriebene Hoffnung,
dass die Würde des Menschen unverlierbar ist, wird
– wie in Döblins autobiografischer Schilderung nachzulesen
– für den Autor auf eine furchtbare Probe gestellt.
Er muss sein Credo auf der Flucht vor den Nazis
behaupten. Der Schriftsteller auf der Suche nach Frau
und Sohn gerät selbst in die Rolle Biberkopf-Hiobs.
Aus seiner Berliner Heimat vertrieben, irrt er durch
das besetzte Mittelfrankreich, um seine evakuierten
Angehörigen ausfindig zu machen. Dass er diese
Odyssee überhaupt zu ertragen vermag und – anders
als Walter Benjamin, der sich 1940 aus Angst vor Auslieferung
an der französisch-spanischen Grenze das
Leben nimmt – die Kraft findet, nicht zu verzweifeln,
hängt letztlich damit zusammen, dass sich ihm die
Wirklichkeit als sinnvoll und tragfähig erschließt. Der
Verfolgte spricht von einem „Ruf“, den er hört. „Es ist
der Ruf, der uns von den beiden Abgründen zurückreißt,
zwischen denen unsere Existenz verläuft; zwischen
dem, der in den Sumpf des kreatürlichen Vegetierens
führt, und dem der Verzweiflung.“
„Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter
geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und
mehr Nacht? Müssen nicht die Laternen am Vormittage
angezündet werden?“, lässt dagegen Nietzsche
seinen „tollen Menschen“ in der „Fröhlichen Wissenschaft“
ausrufen. Atheismus ist danach keine unverbindliche
Floskel. Indem die Existenz Gottes radikal
in Frage gestellt wird, werden die Grundfesten von
Oben und Unten, Gut und Böse, Recht und Moral erschüttert.
Der Philosoph diagnostiziert damit die
Auflösung der tiefsten menschlichen Verankerung.
Und dieses Wegbrechen zivilisatorischer Fundamente erlebt Döblin in seinem Wettlauf mit Hitlers
Bluthunden. Doch zum Symbol für eine Welt,
die ihren letzten Halt nicht verliert und
nicht in einem Schwarzen Loch verschwindet,
wird für den „Alexanderplatz“-Autor
das Kreuzes-Zeichen. Es verbindet Himmel
und Erde. Das Kreuz erinnert ihn an die absolute
Entäußerung Gottes; dieser hat für
sich selbst in der Menschwerdung Jesu die
Hiob-Rolle reserviert. Darum wird der bloße
Anblick einer Kirche in der Silhouette der
Städte für den gehetzten Schriftsteller zum
tiefsten Ausdruck für die Sinnhaftigkeit des
Lebens. „Ich brauche nicht in die Kirche zu
gehen. Der Anblick der Kirchen erfreut mich.
Denn da drin, weiß ich, hängt er am Kreuz.“
Stadt ohne Gott? Vom Wagnis christlicher Nachbarschaft
„Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe,
Niggertänze, Poker und Rennwetten“
– man wird das alles in Rom wiederfinden“.
13 Was Oswald Spengler bereits für die
antike Weltstadt diagnostiziert, gilt seiner
Auffassung nach in verschärfter Form für das
unheilige Berlin sowie für die Massenkultur
des 20. Jahrhunderts. Zur Verteufelung der
Großstadt hat der agrarromantische Autor
von „Der Untergang des Abendlandes“ einen
entscheidenden Beitrag geleistet. Alle Kulturen,
so seine Überzeugung mit Blick auf
das Berlin der Theater und Kabaretts, der
Varietés und ungezählter Vergnügungsmöglichkeiten,
durchlaufen einen Lebenszyklus:
von der Kindheit über das reife Mannesalter
bis hin zu Vergreisung, Absterben und Tod.
Die finale Diagnose des „Untergangs“-Autors
lautet: Erlöschen der Lebenskraft. Der
„Steinkoloß ‚Weltstadt’“ stehe ganz am Ende
des Lebenslaufes einer jeden großen Kultur.
Der Kulturmensch werde von seiner eigenen
urbanen Hervorbringung „in Besitz genommen,
besessen, zu ihrem Geschöpf, ihrem
ausführenden Organ und endlich zu ihrem
Opfer gemacht.“
Stadtplaner rechneten zu Spenglers Zeit
die Einwohnerzahl der deutschen Hauptstadt
für die Zukunft hoch: Sie kamen auf
10 Millionen Berliner für das Jahr 1950.
Durch urbane Konzentration, diagnostiziert
der Kulturpessimist, trete immer wieder die
gleiche Konstellation zutage: der Verlust
aller vitalen Kräfte eines Volkes. Als Folge
degeneriere der dem ländlich-natürlichen
Leben entfremdete „Großstadtbewohner,
der reine traditionslose, in formlos flukturierender
Masse auftretende Tatsachenmensch“
zu einer Art „Parasit“, der zwar
findig daherkomme, sich letztlich aber als
„irreligiös“ und „unfruchtbar“ erweise.15
Der Untergangs-Prophet malt das Bild eines
verruchten Sünden-Babel an die Wand – und
hat dabei Berlin vor Augen. Tatsächlich wird
die Reichshauptstadt in der Spätphase der
Weimarer Republik zum großen Labor der
Moderne und bringt einen eigenen Typus
hervor: den nervösen, kühl-distanzierten,
dennoch leicht erregbaren, sportiven Stadtmenschen.
Der im Berliner Westen aufgewachsene
Historiker und Publizist Sebastian Haffner
etwa spricht vom Massenwahn Sport.
„Boxer und Hundertmeterläufer wurden zu
Volkshelden (…). Es ist der letzte große deutsche
Massenwahn, dem ich selbst erlegen
bin. Zwei Jahre lang stand mein geistiges
Leben fast still, und ich trainierte verbissen
Mittel- und Langstreckenlauf und hätte
meine Seele unbedenklich dem Teufel dafür
verkauft, ein einziges Mal 800 Meter unter 2
Minuten zu laufen.“
Heilig und zugleich profan! Wie die Religionspädagogik
eindrucksvoll zu zeigen
vermag, ist die Weitergabe von Werten und
Glaubensüberzeugungen in schwierigen religiösen
Feldern vor allem auf persönliche
Vorbilder angewiesen. Christentum ist wesentlich
soziales Miteinander. Schon in der
frühen Kirche heißt es bei Tertullian: unus
christianus – nullus christianus, also ein Christ – kein Christ. Aber wo findet man exemplarische
Christen mit einem überzeugenden Lebensentwurf?
Ich denke, dass die Gestalten, nach denen da
gerufen wird, keine leidenschaftslosen Wesen sind,
sondern Geschöpfe aus Fleisch und Blut, mit Siegen
und Niederlagen. Sie sind wirkliche Menschen, die,
von ihrem Glauben an den inkarnierten Gott bewegt,
etwas zum Besseren verändern wollen und dabei ansteckend
wirken.
Berlin: Ort des Sehens – Urteilens –
Handelns.
Bei meinen eigenen Suchbewegungen
bin ich auf drei Glaubenszeugen gestoßen, die
mich menschlich-christlich gleichermaßen beeindrucken
und berühren. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
haben sie die deutsche Hauptstadt als ihre
große Herausforderung begriffen und angenommen:
als Ort des Sehens – Urteilens – Handelns.
Solchen „burning people“ und Großstadtglaubenden
begegne ich – neben dem schon erwähnten Carl
Sonnenschein – in Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
mit seiner „Diakonie aus politischem Widerstand und
Ergebung“ und Romano Guardini (1885-1968) in seiner
„Diakonie des denkenden Glaubens“. Jeder für
sich geht – auf unverwechselbare Weise – daran, unter
den zugespitzten Bedingungen der Metropole von
der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu sprechen
und dies mit dem Einsatz seiner ganzen Existenz zu
bezeugen. Andere exemplarische Christen wie Bernhard
Lichtenberg, der für die verfolgten Juden betete,
oder Margarete Sommer, die unermüdlich darum
kämpfte, „Nichtarier“ vor der Deportation zu retten,
ließen sich anführen.
Sonnenschein, Bonhoeffer und Guardini liegen mir
am Herzen, weil sie sich in ihrer Glaubens-Existenz
rückhaltlos für ein Prinzip einsetzen, das für mich
unter den spannungsreichen Lebensbedingungen des
ostdeutschen Obrigkeitsstaats zum zentralen Thema
geworden ist: die Hoffnung, dass Menschen mit unterschiedlichen
Credos, Konfessionen und Weltbildern
in der Lage sind, nachbarschaftlich miteinander
umzugehen.
Können Christen und Atheisten, Glaubende und
Nichtglaubende friedlich als „Nachbarn“ miteinander
leben? Gibt es wirkliche Begegnung zwischen
ihnen? „Die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen
Großgruppen“, hält der Erfurter
Fundamentaltheologe Michael Gabel dazu fest, „lässt
deren Mitglieder einander fremd sein, die Nähe im
Siedlungsraum ermöglicht hingegen Wechselbeziehungen
der Nachbarschaft. Diesen Umstand nahmen
in den späten Jahren der DDR Bischöfe zum Anknüpfungspunkt,
das Bewusstsein für die missionarische
Aufgabe der Kirche zu stärken. Um der Agonie eines
innergesellschaftlichen Ghetto-Zustandes der Kirche
entgegenzuwirken, forderte etwa Bischof Wanke das
Bewusstsein für Nachbarschaftshilfe als einen konkreten
Schritt der Zuwendung der Kirche zu den Menschen
ein.“
Zur Person
Thomas Brose
ist Professor für Philosophie in Berlin.
1989 war er aktiv bei der Friedlichen Revolution und war
lange Jahre in der Hochschulpastoral tätig. Er leitete an
der Universität Erfurt ein Forschungsprojekt zu Konfession,
Bildung und Politik. 2018 erschien von ihm „Kein hoffnungsloser
Fall: Gott und Mensch bei Eugen Biser. Eine
Einführung“ (Peter Lang Verlag).