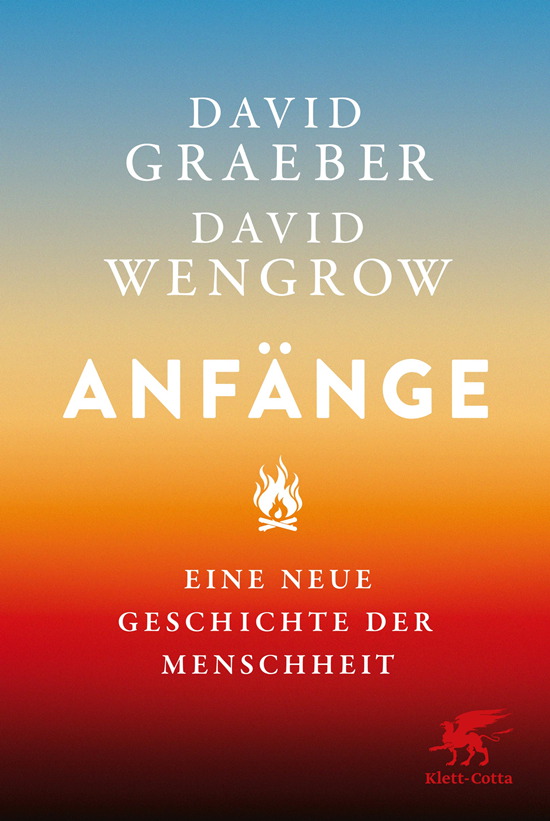
Bestellen
auf Buch7.de - sozialer Buchhandel
David Graeber / David Wengrow: Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit
Was haben Karneval, Weihnachten, die Zeit zwischen den Jahren und die großen Ferien mit menschlichen Kulturen zu tun, die 45.000 Jahre vor uns existierten, etwa den Erbauern von Stonehenge oder den Naturvölkern im Amazonas-Gebiet? Warum sollten wir vielleicht besser nicht von einem kontinuierlichen „Fortschritt der Menschheit“ ausgehen, der immer die abwerten muss, die auf irgendeiner der von europäischen Ethnologen definierten Entwicklungsstufe „stehengeblieben“ sind? Die Antworten erfahren wir aus dem bahnbrechend-aktuellen ethnologischen Bestseller des jüngst verstorbenen Star-Autors David Graeber und seines Kollegen David Wengrow. Das allerdings ist eine Herausforderung, muss man hier doch neben dem umfangreichen Literatur- und Anmerkungsapparat immerhin 560 Seiten Text bewältigen.
Die beiden Autoren machen es aber dem Leser/der Leserin zunächst leicht, denn, wie üblich im angelsächsischen Raum, schreiben sie leicht verständlich, verzichten auf eine streng wissenschaftliche Gliederung und Argumentation, nehmen dafür aber die Interessierten mit auf ihren eigenen faktenreichen und innovativen Denkweg. So entstehen dann Kapitelüberschriften wie die folgende: „Wie Jean-Jacques Rousseau, nachdem er einen renommierten Essaywettbewerb gewonnen hatte und aus einem anderen ausgeschieden war, die gesamte Menschheitsgeschichte eroberte.“
Um große Fragen geht es den Autoren: Die „Ursachen von Krieg, Gier, Ausbeutung und der systematischen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer. Waren wir schon immer so? Oder ist an irgendeinem Punkt etwas schrecklich missraten.“ (13) Hier wird also nach dem Wesen des Menschen gefragt, aber eben nicht in metaphysischer Abgehobenheit, sondern als Ergebnis sozioökonomischer Zusammenhänge, die jedem Individuum im Rahmen seiner kulturellen Prägung nur bestimmte Handlungsoptionen lässt, ihm bestimmte moralische Kodizes an die Hand gibt. „Im Grunde genommen ist es eine theologische Debatte“ so schreiben Graeber und Wengrow auf den ersten Seiten ihres Werkes.
Sie vermuten, die Antwort auf diese Fragen in einer genauen Analyse der Menschheitsgeschichte zu finden, und nehmen den Leser sofort mit auf den Weg in eine Debatte, die seit Jean-Jacques Rousseaus „Diskurs über die Ungleichheit“ und Thomas Hobbes‘ „Leviathan“ anhält und verstärkt im 20. Jahrhundert geführt wurde: von Autorinnen und Autoren wie Marcel Mauss, Claude Levi-Strauss und Marjam Dibutas, deren Werke „Die Gabe“, „Das Wilde Denken“ oder „Göttinnen und Götter im Alten Europa“ auf ethnologischen Feldstudien bei „von der Zivilisation unberührten Naturvölkern“ oder aber auf großangelegten archäologischen Ausgrabungen vor allem im sogenannten fruchtbaren Halbmond, also in Kleinasien und dem Nahen und Mittleren Osten fußen – gegenwärtigen und vergangenen Orten also, wo man „die Wiege der Menschheitskultur“ vermutet. Vor allem um die angeblich normative Abfolge von Jäger und Sammler über Ackerbau hin zu Stadtkulturen geht es den Autoren, die sie als „natürliche Evolution“ in Frage stellen. Denn, dies sei „1. schlicht und einfach unwahr, 2. mit schlimmen politischen Konsequenzen verbunden und 3. dafür verantwortlich, dass die Vergangenheit langweiliger als nötig erscheint“ (16).
Im ersten Kapitel wird zudem deutlich, dass erst der Kontakt mit Vertretern indigener Kulturen aus dem Amerika des 16. bis 18. Jahrhunderts die europäische Debatte um Freiheit und Gleichheit befeuert haben dürfte: Die Selbstverständlichkeit und argumentative Stringenz, mit der die nach Europa verfrachteten „Indianer“ wie der Wendat-Philosoph und Staatsmann Kondiaronk Herrschaftsverhältnisse, Geldwirtschaft, Moral und Religion der europäischen „Hochkulturen kritisieren“, wird im zweiten Kapitel an verblüffenden Beispielen dargestellt: „Offenbar gab es also einen Grund dafür, warum so viele wichtige Denker der Aufklärung darauf beharrten, ihre Ideale von persönlicher Freiheit und politischer Gleichheit seien durch indigen-amerikanische Quellen und Beispiele angeregt worden. Weil es stimmte“ – so die beiden Verfasser (52). Und das angebliche Gefälle zwischen der Zurückgebliebenheit prähistorischer Kulturen und dem „kultivierten“ Europa wirkt im Rückblick befremdlich: „Empörte Missionare berichteten regelmäßig, man gestehe amerikanischen [Indio-]Frauen die vollständige Gewalt über den eigenen Körper zu, sodass unverheiratete Frauen sexuelle Freiheiten besäßen und verheiratete Frauen sich nach Belieben scheiden lassen könnten.“ (59)
Für die Wirkungsgeschichte für diesen und alle folgenden „Clashs of Civilizations“ sowie für sämtliche ethnologischen und anthropologischen Debatten entscheidend ist der von dem Ethnologen Gregory Bateson (1904-1980) geprägte Begriff der „Schismogenese“. Er zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch und beschreibt das Phänomen, dass nur leicht unterschiedliche Kulturen und Positionen sich durch wechselseitige Abstoßung bis hin zu Extrempositionen wandeln können, so dass anthropologische Gemeinsamkeiten etwa in wechselseitigem Streit der Nationen und Kulturen bis zur Unkenntlichkeit von der Überbetonung von Unterschieden und der Polarisierung von Positionen verschlungen werden können, wie dies etwa im Zeitalter der Konfessionalisierung mit dem ehemals „einen“ Christentum geschah. Nur so ist zu erklären, dass in den Augen von Philosophen und Ethnologen bis heute die eigene Kultur stets fortgeschrittener erscheint als die der frisch entdeckten Indigenen oder untergegangener Hochkulturen.
In den weitschweifig angelegten Kapiteln 3 bis 6 wird zunächst en detail mit dem Vorurteil aufgeräumt, „Jäger- und Sammlergesellschaften könnten [keine] Institutionen entwickeln, die es erlaubten, große öffentliche Arbeiten und Projekte durchzuführen und monumentale Bauwerke zu errichten“ (165). Die Stonehenge-Kulturen, Poverty Point in Louisiana und das noch viel größere saisonal betriebene Heiligtum in Zentralanatolien Göbekli Tepe beweisen das Gegenteil. Das „Stereotyp vom sorglosen faulen Eingeborenen“ (170) oder der Zustand „kindlicher Einfalt“ (169), die in der Kolonial-Ideologie gepflegt und mit dem die massenhafte Unterdrückung und Versklavung indigener Völker gerechtfertigt wurden, resultiert aus dem tatsächlich wesentlich lockereren Tageszeitplan von Jägern und Sammlern. In allen Weltgeschichten bis hin zu der erfolgreichsten von Yuval Harari wird fälschlicherweise der darauffolgende Schritt zum Ackerbau als ein mühsamer, mit viel Aufwand der Aufzucht, Hege und Pflege der domestizierten Pflanzen und Tiere verbundener Weg beschrieben, der den Ertrag der Kultur und des Lebens auf einer höheren Entwicklungsstufe mit sich gebracht habe.
Graeber und Wengrove räumen auch mit einem weiteren folgenreichen Vorurteil auf, indem sie neben vorkolumbianischen amerikanischen „Kulturarealen“, die sich in Kenntnis benachbarter Ackerbauern frei für ein Dasein als Jäger und Sammler entschieden, sich ausführlich mit Çatalhöyük, der ältesten (jungsteinzeitlichen) Stadt der Welt, beschäftigen. Hier waren es Frauen, deren Anerkennung sich in der Vielzahl der als „Fruchtbarkeitsgöttinnen“ missverstandenen Skulpturen aus dieser Zeit niederschlug, die eine völlig neue „matriarchale“ Variante der wenig arbeitsaufwendigen und doch effektiven Nutzung der Natur entwickelten: „Indem sie Saatgut im Hochland sammelten und auf Schwemmgebieten im Tiefland ausbrachten, setzten sie einen Prozess der Divergenz und Domestizierung in Gang. […] Frühe Ackerbauern, so scheint es, taten nur das Allernötigste, um ihr Auskommen zu sichern und an ihrem jeweiligen Ort bleiben zu können, den sie nicht wegen der Landwirtschaft, sondern aus anderen Gründen bevölkerten; dazu gehörte das Jagen, Sammeln und Fischen, der Handel und vieles mehr.“ (261) Die neolithische Revolution fand also im eigentlichen Sinne niemals statt. Sie war bestenfalls eine Evolution.
Und: Die Entstehung von „Eigentum“ im heutigen Sinne war mit dieser Entwicklung ebenso wenig verbunden: Vielmehr lernen wir fast nebenbei zur „Frage des Eigentums und ihrer Beziehung zum Heiligen“ (178-185): Schon früh entwickeln sich Formen des „heiligen Eigentums“, die im Sinne des polynesischen Wortes „tabu“ sind: Götter und Geister sind die eigentlichen Besitzer dieses Gegenstandes oder ganzer Landstriche. „Sterbliche Menschen waren […] bestenfalls Hüter.“ (182) Eigentum kann in diesen Kulturen also nur im Sinne einer Verantwortlichkeit, eines Schutz- und Pflegeauftrags sakraler Rituale, Orte und Gegenstände auf Lebenszeit verstanden werden.
In den Kapiteln 8 bis 10 verwenden die Autoren viel Zeit darauf, mit stupendem Wissen über quasi alle prähistorischen Städte weltweit auszufalten, dass wir über deren Regierungsform wenig wüssten, außer, dass sie keineswegs wie in der gängigen Forschung Konsens, immer monarchisch regiert wurden. Von der südamerikanischen Stadt Tlaxcala könne man jedenfalls nach den Quellen des Konquistadoren Cortez sicher von einer demokratischen Regierungsform ausgehen. Da der (spät entstehende) europäische Staatsbegriff nach Rudolf von Jhering (19. Jahrhundert) in der Tradition des römischen Rechts allerdings vor allem auf der Legitimation körperlicher Zwangsmaßnahmen fuße und wegen ihrer oben schon benannten Saisonalität, fielen viele der beschriebenen prähistorischen Stadtstaaten, die ohne gewaltsame Strafmaßnahmen auskamen, durchs Raster. Deshalb werden als weitere Kriterien für Staatlichkeit Wissenskontrolle und individuelles Charisma vorgeschlagen. Vor allem geht es den Autoren aber darum, in Bezug auf soziale Systeme teleologisches Denken nach dem Muster Kindheit – Blüte – Verfall zu unterminieren (409).
Vor allem Archäologen, Anthropologen und Ethnologen dürften die noch folgenden Kapitel interessieren, in denen die genannten Thesen mit weiteren Phänomenen angereichert und belegt werden. Dem in diesen Disziplinen laienhaften Leser dient das Buch gleichwohl als ein umfassendes Kompendium aktueller Debatten in diesen Disziplinen und der Einsicht, dass alles ganz anders gewesen sein könnte. Wir haben also guten Grund, unseren Hochmut gegenüber nicht europäischen Kulturen endgültig abzulegen und ihnen künftig mit Demut und Neugier zu begegnen.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm, Andreas Thomsen
Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. 2022
667 Seiten
28,00 €
ISBN 978-3-608-98508-5

