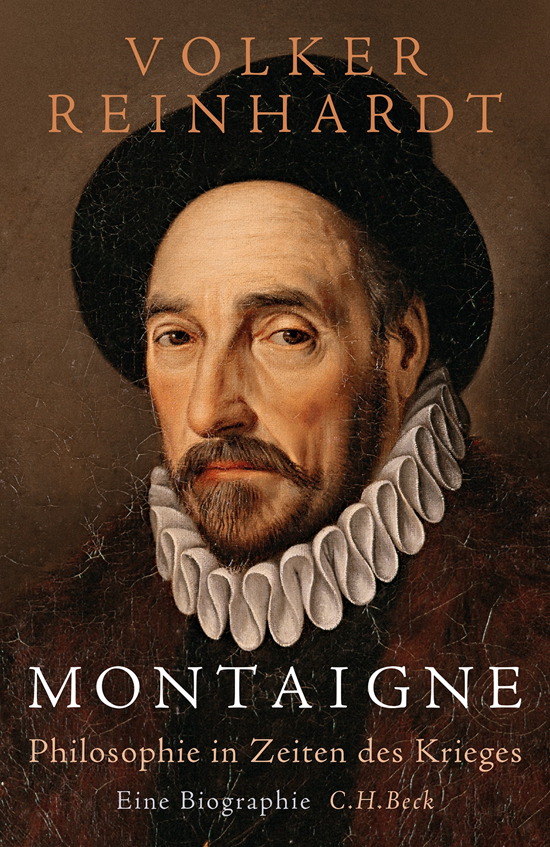
Bestellen
auf Buch7.de - sozialer Buchhandel
Volker Reinhardt: Montaigne. Philosophie in Zeiten des Krieges
Es ist gewiss nicht nur seine Einschätzung der 40-tägigen Quarantäne während der Pest, in der sich Michel de Montaigne (1533-1592) als unser Zeitgenosse erweist: In dieser Zeit „tobt sich die Einbildungskraft erst richtig aus und macht die Gesunden krank“ (zit. 243). Gewiss stünde er jedoch nicht auf der Seite der Querdenker, dazu hat er ein zu ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedeutung einer stabilen – was damals hieß: aristokratischen und katholisch begründeten – Ordnung. Gleichzeitig fordert er diese durch seinen Skeptizismus heraus, kritisierte vor allem die Korruption (120) und wurde deswegen häufig als Nestbeschmutzer angesehen. So wurde einerseits seine ansehnliche Karriere, die er bis zum Magistraten und Bürgermeister von Bordeaux gebracht hatte, wegen seiner ironischen Gesellschaftskritik jäh gestoppt (71), während er andererseits eine gegen die kirchliche Lehre, jeden Dogmatismus und Traditionalismus, aber auch den klassischen Humanismus selbst gerichtete Lebenskunst lehrte (275): Gegen den Zeitgeist des Inquisitionszeitalters solle jeder „nach seiner eigenen Façon glücklich“ werden (153). Diese kam in seinem Hauptwerk „Essais“ zum Ausdruck, die er im Jahr 1580 erstmals publiziert höchstpersönlich in Rom der Indexkongregation vorlegte (185) – die komplette, auf der Grundlage von Montaignes Version 1588 herausgegebene Ausgabe erschien bezeichnenderweise nach deren letztendlicher Indizierung im Jahr 1676 erst 1802.
„Die Menschen lieben die Moralapostel und ihre Predigten nicht, deshalb muss man andere Wege einschlagen, wenn man sie zum Guten anspornen und anleiten will“ (17): Durch diese Einsicht ist Montaigne uns Zeitgenosse, wenn wir an die festgefahrenen und wenig generativen gesellschaftlichen Konsense – oder was von ihnen übrig ist – denken. Seine Pädagogik als Gesellschafts- und Zeitkritik auf der Basis glaubhafter Ironie – glaubhaft, weil sie stets auf gestandener Selbstironie und der Herausstellung der eigenen Gewöhnlichkeit beruht – wird von Volker Reinhardt in dieser munter lesbaren und mit Biographie sowie Zeit- und Sozialgeschichte verknüpften Abhandlung dargelegt.
Den Adelstitel, zu dem es sein Vater gebracht hatte, was für Montaigne (eigentlich Eyquem) zeit seines Lebens eine große Verpflichtung sein sollte, stellt er häufig heraus, um gehört zu werden – andererseits stapelt er tief und betonte seine Schwächen, nicht nur um glaubwürdig zu sein, sondern auch um seine Unabhängigkeit von jeglichem Urteil der Leser zu wahren (23). Damit ersetzt er das humanistische Prinzip des tugendhaften Exempels durch die Pädagogik seiner eigenen Fehlbarkeit und seiner „eher durchschnittlichen Neigungen und Fähigkeiten“ (288). In die „freiwillige Knechtschaft“ – zusammen mit seinem Freund und Philosophen Etienne De la Boétie (1530-1563) diagnostizierte er die „vorauseilende Unterwürfigkeit“ der Menschen als Nährboden der Tyrannei (75) – begab er sich nämlich nie. Zeit seines Lebens kritisierte er Fanatismus und Grausamkeit, von denen das 16. Jahrhundert zwischen Fehden und Plündereien, den konfessionellen Auseinandersetzungen und dem Regime Catherine de Médicis, Inquisition und Hexenverbrennungen, voll war. Der „Krieg der Geschlechter“ (85) und viele weitere gesellschaftliche Missstände werden in seinen insgesamt 107 „Essais“ kritisch und mit skeptisch-ironischer Zunge behandelt. Begonnen nach der Bartholomäusnacht (23.-24. August 1572), hatte Montaigne sie in seinem Turm vollendet, in den er sich vor der Pest 1585 zurückgezogen hatte.
Philosophie ist für Montaigne jedoch nicht nur Skeptizismus, sondern auch gemäß einer antiken Denktradition Ars moriendi: Gerade hier bringt er die Synthese von stoischer und christlicher Tradition und präsentiert eine „Anleitung um Sterben für humanistische gebildete Intellektuelle“ (78), die aber später von Montaigne zusammen mit Lukrez „weder Christus noch Seneca“ anvertraut wird, sondern der Natur, welche uns durch den Schlaf auf den „ewige[n] Schlaf“ des Todes vorbereitet (96-97). Gerade in seiner Natur – gegen die christliche Idee der Erbsünde als in sich unschuldig angesehen (155) – betrachtet, hat der Mensch nichts von den „hochgemuten Konstruktionen“ von Stoa und christlicher Religion und sollte sich eher, die Natur und das Weltall betrachtend, in Demut üben (138-139). Der Mensch zeichnet sich nicht vor den anderen Lebewesen aus – nicht einmal durch die Sprache –, sondern ist ihnen im Gegenteil in seiner Sterblichkeit gleich. Von großen Philosophen wie Pascal wurde er dafür verachtet (147). Und wenn Montaigne dann schreibt: „Wer zu sterben gelernt hat, hat verlernt zu dienen“ (zit. 146), dann hat er hier bereits die Brücke zu seinem mit de la Boétie gemeinsamen Eintreten für die Freiheit geschlagen. Nicht die Orientierung an Offenbarung und kirchlicher Autorität, sondern an der Natur ist für ihn die letztliche Verbürgung freien und unabhängigen Denkens. De la Boéties „Discours de la servitude volontaire“, der das Bewusstsein der Freiheit schärfte, nahm Montaigne jedoch nicht in die Edition dessen Schriften auf, die er 1571 für den verstorbenen Freund anfertigte, um angesichts der geringen Aufgeschlossenheit seiner Zeit für die Freiheit dessen Andenken nicht zu trüben (76). Diese Sammlung widmete er sodann dem Kanzler De l’Hospital, welcher im Konfessionsstreit, aber auch in seiner Aufsicht der Justiz von aller Parteilichkeit fernblieb und deswegen wie kein anderer Politiker Montaignes ungeteilte Anerkennung verdiente.
Einerseits forderte er das Politikverständnis seiner Zeit heraus („Das öffentliche Wohl verlangt, dass man Verrat übt und lügt [...] und Massaker anordnet“; zit. 223), andererseits relativiert er die Bedeutung der Religion für den Erhalt des Friedens: „Frieden und nationale Einheit sind wichtiger als der Streit der Kirchen.“ (222) Seine Philosophie des Zweifels drückt sich in seiner durchaus belesenen und gebildeten Wissenschaftsskepsis bzw. -ignoranz aus (142) – welche nicht der herkömmlichen Ignoranz vor allem der „einfachen Modellchristen“ gleichkommt (143) –, wenn er etwa die Kalenderreform Gregors XIII. ablehnte (224) oder Jurisprudenz und Medizin als „vermeintliche[s] Wissen der Gelehrten“ ansieht (150). Damit zeigt Reinhardt auf, wie der Skeptizismus zu Banalität oder Polemik verkommen kann (263), wenngleich Montaigne dadurch seinem Wissenschaftsverständnis Ausdruck verleiht, dass wahres Wissen nicht durch Autorität, sondern durch Relativierung und Bezweiflung aller Aussagen erlangt wird (266).
Die Spektakel der barbarischen Menschenfresser, welche die damalige Gesellschaft so sehr schätzte und zum Anlass des Besuchs des Königs veranstaltet wurden, kritisierte Montaigne scharf. Er fragte dabei ironisch, ob es wirklich die anderen Völker oder doch nicht die Europäer seien, die hier barbarisch erscheinen (88-89). Die Schönheit von deren Nacktheit als Einfachheit der natürlichen Gesellschaft und Polygamie kontrastiert mit der hierarchischen Gesellschaft und der tristen Realität der Ehe in Europa, wobei sich die Kannibalen den Europäern darin überlegen erweisen, Menschen wenigstens nicht lebendig – d. h. „aus Frömmigkeit und Religion“ – zu verzehren (zit. 91). Und wenn die Bibel die Existenz von Hexen zweifelsfrei annehme, so dürfe man keineswegs hiervon auf die Gegenwart schließen (268-269).
Im Jahr 1571 wurde er von Karl IX. zum Ritter erhoben sowie in den Ordre de Saint-Michel aufgenommen (119), und seine Loyalität zur Krone sah er nur durch das Massaker der Bartholomäusnacht aufgehoben. Als sich das Gemetzel von Paris aus auf ganz Frankreich ausbreitete, befand er sich zu seinem Glück in seinem Schloss außerhalb von Bordeaux, wo er als Gemäßigter und Vermittler der Parteien sein Leben riskiert hätte (127): Aufgabe des Staates sei es, die Gegensätze zwischen den Religionen zwar zu vergrößern – da die Religionen sich nur durch die Absetzung von den anderen verinnerlichen und damit die Fähigkeit zur Toleranz ausbilden – und dabei die gewaltsame Eskalation zu vermeiden (176). Denn seiner Analyse zufolge wird die Gerechtigkeit im Krieg nur zur Verschleierung der eigenen Interessen beschworen und „die Menschen bedienen sich der Religion für ihre Zwecke. Dabei müsste es genau umgekehrt sein“ (zit. 128; vgl. 212). So erklärt es sich, dass die verschiedenen Religionen oftmals dieselben Versprechen oder Drohungen in völlig entgegengesetzter Weise dogmatisieren und damit zur Gelegenheit von Ausübung menschlicher Gewalt werden: Man gehört mithin einer Religion aus kulturellen Gründen und Konvention an und ein Religionswechsel ist Ausdruck von Zweckmäßigkeit (207).
Aus den „Essais“ tritt mithin ein skeptischer Humanismus hervor, welcher nicht autoritär lehrt, sondern die Adressaten dazu befähigt, selbst zur Wahrheit zu gelangen: „Nur im Zeichen des alles umfassenden und durchdringenden Zweifels ist das Leben lebenswert.“ (136) Dieser darf jedoch nicht als Waffe gegen die anderen, sondern muss als Mittel zur Selbstrelativierung angesehen werden. Nur so tritt er einem „Grundübel der Zeit“ – auch der unsrigen – entgegen, nämlich der „Unfähigkeit, dem anderen die Freiheit im Denken und Reden zuzugestehen, die man selbst für sich in Anspruch nimmt“ (258). Und einen zweiten Rat gibt er, sich auf Augustinus berufend, uns mit, nämlich „dass es in Dingen, die schwierig zu beweisen sind und die einen gefährlichen Glauben nach sich ziehen, besser ist, zum Zweifel als zur Bestätigung zu neigen“ (271). Damit ist Montaigne und vor allem diese gelungene Einführung Reinhardts all denen anzuraten, die heute noch an die gesellschaftliche Bedeutung von Vernunft, Verständigung und Frieden glauben (124).
Eine Biographie
München: C.H. Beck. 2023
330 Seiten m. Abb
29,90 €
ISBN 978-3-406-797415

