Worte zum 23. Psalm - Ostern 2020
Eine persönliche Message an Freunde.

Liebe Religionslehrer
Einige von Ihnen habe ich ja vor Monaten persönlich kennengelernt, das macht es leichter, zu Ihnen zu reden, so in einer persönlich an Sie gerichteten Message. Ich spreche sie auf dasselbe kleine Diktiergerät, von dem ich Ihnen damals sicherlich erzählt habe – das Ding, auf dem ich die am Morgen oder in der Nacht noch erinnerten Träume festhalte.
Vor einer Woche erfuhr ich – kein Traum -, dass ein Freund auf der Intensivstation liegt und beatmet wird. Corona-Virus.
„Betet für uns!“, schrieb seine Frau. Sie sei nur noch am Weinen.
Ich empfahl ihr den 23. Psalm – schrieb ihn ihr Zeile für Zeile auf, mit leichten Änderungen, damit sie das Gebet für ihren Mann und für sich selbst beten könnte, mithin beide am selben Tisch säßen, von dem ja auch der Psalm spricht:
„Du bereitest vor mir einen Tisch – im Angesicht meiner Feinde“.
Sie identifizierte „die Feinde“ gleich mit dem Virus. Das Bild zwang sie sozusagen: zu einer Visualisierung. Wie dieser „Feind“ aussah, weiss nur sie. Prinzipiell aber kommt eine solche konzentrierte Sichtung des Feinds im Gebet dem Moment der Erhöhung der ehernen Schlange gleich, Numeri Kapitel 21:
„Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.“
Ich schrieb ihr den 23. Psalm auf, weil man in so einer Situation – mit den Nerven am Ende – vielleicht nicht in der Lage ist, nach einer Bibel zu schauen oder den Suchbefehl im Computer einzugeben. Weil man – gerade JETZT, da man sie liest, diese Verse – genau auf der Stufe, der tiefen Stufe dieses Psalms sich befindet, der seelischen Tiefe, aus der er selbst spricht. JETZT – sind die Zeilen da, sind sie vor Augen - mit der Aufforderung:
Lies
Lies es laut!
Lies es jetzt, Dir vor Augen.
Sieh die Bilder einzeln vor Dir, in ihrer Sequenz, der Individuationsfolge, die der Psalm uns bebildert.
Schon am nächsten Tag – ging es ihrem Mann besser. Drei Tage später sagten die Ärzte, er sei aus der Lebensgefahr-Zone heraus. Er liegt immer noch dort. Ich schrieb seiner Frau zwei weitere mails, die sich mit einzelnen Zeilen des Psalms und dem Wandlungsprozess beschäftigen, den seine Verse beschreiben.
Zum Schluss sandte ich ihr eine Version des Psalms – wie ich ihn mir selbst übersetzt hatte – aus dem Hebräischen. Es ging mir dabei keineswegs darum, die ehrwürdige, millionenfach geprüfte, Milliarden mal gebetete Luther-Übersetzung beiseite zu schieben, die ja in ihrer Sprache fast an die geradezu heiligen – weil tief-bewährten - Übersetzungen der King James Psalms, der Vulgata- oder Septuaginta-Übersetzungen reicht. Sondern einzig darum, die im Original anklingenden, mitverborgenen Bilder zu fassen, jene Bilder nämlich, die in den Etymologien einzelner Wörter und Wendungen – das heißt: von den gleichsam unbewussten Schichten der Sprache her – anklingen. Eine Musik, die im Hintergrund mitzuhören, vielleicht mit zu bedenken wäre, die bekannten Lutherzeilen uns hoch aufzurichten.
Ich habe den 23. so übersetzt:
Er zeltet mich in frischer Grüne, er tränkt mich am Wasser des Atems der Ruh.
Meine Seele, zu mir heimgekehrt hat er sie.
Er führt mich auf Wegen der Gerechtigkeit - um Seines Namens willen.
Durchs Tal des Schattenbildes des Todes muss ich mitten hindurch. Doch ich fürchte kein Unglück. Denn du bist mit mir. Die Krümm deines Stabs – Mut zieht sie aus mir, tappt mir zeptergleich Richtung und Trost.
Da! Vor meinen Augen: du bereitest mir einen Tisch, daran ich ansichtig sei meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl – und schenkst mir voll den verwandelnden Kelch.
Deine Gnade – erjagt sie mich nicht alle Tage meines Lebens? So soll es sein.
Eingezeltet in Gnade werde ich wohnen im Hause des Herrn - immerdar.
Es ist, sie haben es gerade gehört, eigentlich ein Wandlungs- und damit ein Auferstehungspsalm - dessen Wirkung und Verwirklichung ich mir für uns alle in diesen Tagen wünsche.
Frohe Ostern!
Patrick Roth
Riverside. Christusnovelle
Eine Unterichtssequenz von Beatrix Mählmann für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe II.
Auszug aus dem Werkbuch zu
Patrick Roths: Die Christus Trilogie
Patrick Roth erzählt
von Schlüsselmomenten
Über Träume und das Schreiben und Lesen von Literatur
Im Gespräch mit Andreas Günter und Ludger Verst
erschienen in DIAKONIA 51 (2020)
Herr Roth, in Ihrem Werk spielen biblische Motive eine starke, um nicht zu sagen: eine zentrale Rolle. In unserer heutigen Gesellschaft, die kaum noch einen bewussten Bezug zur Bibel hat, fällt das Erzählen solcher Stoffe ziemlich aus dem Rahmen. Wie kamen Sie eigentlich dazu, in Ihren Texten auf biblische Motive zurückzugreifen?
Erst einmal möchte ich sagen, dass es für mich etwas ganz Besonderes ist, vor Ihnen als Religionslehrern und Religionslehrerinnen zu sprechen. Es gab in meinem Leben zwei ungeheuer wichtige Religionslehrer – in der ersten Zeit in der Volksschule und dann noch einmal später, in der Oberstufe meines Gymnasiums, es war ein humanistisches Gymnasium mit Griechisch und Latein. Katholische und evangelische Schüler hatte man zusammengelegt, und unser Lehrer war ein noch junger Kaplan, Schildknecht hieß er. Wir dachten zuerst, alles geht weiter wie bisher – mit Bibel aufschlagen und so. Aber der Neue kam mit auf Matrizen abgezogenen Texten ins Klassenzimmer, die er offensichtlich selbst noch am Morgen gemacht hatte. Sie waren noch warm und manche Passage war blau verlaufen, auch gab es orthographische Fehler, aber das war uns völlig egal, denn dieser Mann war von seiner Sache begeistert, das war klar. Es ging bei ihm tatsächlich um das, was damals gerade auf der Straße passierte – die Demonstrationen, die Proteste gegen den Vietnamkrieg und so weiter. Wir lasen Texte von Karl Marx und Auszüge aus Feuerbach, dem Religionskritiker. Eines Morgens, ich werde es nie vergessen, geht Kaplan Schildknecht mit der Kreide an der Tafel entlang, zieht in der Mitte einen Strich über die gesamte Breite hin und teilt so die Tafel in eine obere und eine untere Hälfte. »Das ist das Bewusste, und das ist das Unterbewusste « hat er dazu gesagt. Wir sprachen dann über Sigmund Freud und über den Stellenwert, den die Träume für uns haben.
Das Unbewusste und die Träume sind ja – neben der Bibel – zu einer zweiten ganz wichtigen Inspirationsquelle für Ihr Erzählen geworden. Und das wurde damals schon von jenem jungen Religionslehrer angestoßen?
Im Prinzip schon. Wissen Sie, wir waren damals, zumindest einige von uns, sehr literaturbegeistert – vor allem E. T. A . Hoffmann, insbesondere seine Sandmann-Erzählung, aber auch die Geschichten von Edgar Allen Poe hatten es uns angetan. Und hier war eine herrliche Analyse vom Sandmann, die uns so unheimlich zusprach – Freuds Aufsatz Das Unheimliche. Den lasen wir jetzt mit völlig neuen Augen. Wie wichtig, wie lebensentscheidend dieser Kaplan Schildknecht tatsächlich für mich war, erfuhr ich aber erst 10, 20 Jahre später in Los Angeles, als ich – mit Mitte 30 –, erstmals bei mir selbst auf solche inneren Bilder stieß, die von Freud in seiner Traumdeutung um die Jahrhundertwende ans Licht gebracht worden waren. Hätte ich damals in Los Angeles von Freud und seiner Methode der Traumanalyse noch nie etwas gehört, wäre ich komplett hilflos gewesen – ich hätte meine Traumbilder einfach so an mir vorbei gehen lassen. Oder sie hätten mich erdrückt. Es war also wahnsinnig wichtig, was dieser Religionslehrer in uns ausgelöst hatte. Und es hatte eine enorme Langzeitwirkung, denn Freud war für mich, rückblickend gesehen, das Tor zu C. G. Jung, auf dessen Schriften ich in den frühen 90er Jahren stieß.
Und wie, wenn schon nicht im Religionsunterricht, haben Sie dann die Bibel entdeckt?
Na ja, das kam im Grunde durch meine Begeisterung für die Literatur. Die Bibel war für mich und zwei, drei andere aus meiner Klasse zunächst einmal literarisch enorm interessant, denn da war ja vieles an sprachlichen Mustern zu finden, was man auch schon aus dem Altgriechischen kannte. Und diese biblischen Texte waren ja von Luther kongenial ins Deutsche übersetzt. Später in Los Angeles kam die Buber- Rosenzweig Übersetzung dazu – die war für mich auch sehr wichtig. Ich würde also sagen, dass mein erstes Interesse an der Bibel aus der Sprache kam. Die lebte weiter in mir, löste ein Echo aus, an dem ich mich nährte. Diese Sprache blieb in mir und das heißt, dass das, was sie übersetzte, mir etwas zu sagen hatte.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ihrer Faszination für die Sprache der Bibel und Ihrem Interesse für die Träume?
Das kann man wirklich so sagen, denn was mich beim Lesen der Bibel so ansprach, fand ich erst heraus, als ich auf C. G. Jung stieß. Das war viele Jahre später in Los Angeles. Damals, bedingt durch die starke, auch sprachliche Isolation, hatte ich einige sehr eindrückliche Träume, die Bilder enthielten, die ich überhaupt nicht verstand. Sie erschlossen sich mir erst durch das Studium der Werke Jungs und durch eine Analyse. Ich ging dann noch einmal zur Bibel zurück. Aber eigentlich musste ich das gar nicht, denn ich sah jetzt, dass die biblischen, bzw. wie Jung sagen würde, die »archetypischen« Bilder jede Nacht zu mir zu Besuch kamen – in den Träumen.
Es stellt sich ja dann die Frage, was diese ursprünglichen, überzeitlichen Bilder mit dem Menschen zu tun haben, der sie träumt, oder?
Natürlich, ja. Denn die Träume kommen ja zu Ihnen, Sie haben ja den Traum – nicht der Nachbar oder der Kollege, sondern ganz speziell Sie haben diesen Traum und Sie haben ihn heute Nacht. Um zu erkennen, was die zeitlosen Bildes eines Traumes Ihnen zu sagen haben – das wusste ich durch Jung –, muss man sie amplifizieren, erweitern. Wenn Sie herausfinden, welches biblische Motiv hinter einem bestimmten persönlichen Traumbild liegt, fährt es auch verstandesmäßig in Sie, macht sich in Ihnen fest.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
Ich erinnere mich an die Schilderung eines Traums einer Theologiestudentin, die auf Lehramt studiert, also auch Religionslehrerin werden will. Sie war bei einer Tagung dabei, bei der ich unter anderem auch über die Träume sprach. In ihrem Abschlussbericht erwähnt sie einen Traum, wie ihn viele von uns haben und der wirklich sehr oft vorkommt – einen Verfolgungstraum: Sie werden im Traum verfolgt. Etwas will zu Ihnen. Und Sie wollen natürlich keine Berührung damit. Sie verschließen die Tür, drei oder vier Mal. Aber das Andere will eindringen zu Ihnen. Das ist genau der Moment, den die Studentin beschreibt: Dieses Wesen kommt hinter ihr her, sie versperrt die Tür vor ihm, hat sie gerade noch zubekommen. In ihrem Bericht heißt es: »Und dann letztlich aber sahen wir uns durch die Tür in die Augen.« Diese Wendung ist doch ganz erstaunlich! Dieses In-die-Augen- Schauen sollte möglich gemacht werden! Die junge Frau sagt, dass der Traum sie verfolgte, sie hätte ihn zig Mal gehabt. »Aber es könnte ja sein«, schreibt sie, »dass dieses Wesen nur kam, um mit mir zu spielen«. Hier ist es zu einer ersten Annäherung gekommen, eine Verbindung ist geschehen. Es ist wie im Märchen: Wenn Sie sich dem stellen, was Sie verfolgt und den Mut haben, es zuzulassen – es ist ein irrsinniger Mut, der in diesem Moment gefordert ist –, dann verwandelt sich das, was uns Angst macht, just in diesem Moment. Aus dem, was Sie schreckt und was Sie fliehen lässt, wird etwas, was Ihr Leben mit neuer Energie erfüllt und ihm neuen Sinn verleiht. So wichtig können Träume sein!
Sie haben uns gerade eine Passage aus Sunrise – Das Buch Joseph gelesen. Es gibt hier eine unglaubliche Verdichtung und Verschränkung von biblischen Bildern. Komponieren Sie das ganz bewusst oder entsteht diese Vielschichtigkeit erst im Prozess des Schreibens?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt von der jeweiligen Szene ab. Das Kapitel über den Brand des römischen Landhauses zum Beispiel habe ich ganz durchgeplant. Hier ist bis in die 42 Andreas Günter / Ludger Verst / Patrick Roth erzählt von Schlüsselmomenten Diakonia 51 (2020) Windrichtung der Rauchschwaden hinein kaum etwas dem Zufall überlassen – eben weil ein riesiges Chaos ausbricht. In der Gartenszene mit dem ägyptischen Sklaven und dem Aufseher hingegen ist alles erst beim Schreiben entstanden. Es gab natürlich ein Anfangsbild, von dem alles ausging – die Berührung der warmen Mauer durch Joseph. Es war wirklich so: Alles kam aus dem Stein. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt das. Wie es als Kind war, wenn man so eine von der Spätmittagssonne erhitzte Steinmauer berührte, die schon im Schatten liegt, aber noch diese wunderbare Wärme enthält. Darin steckt der ganze herrliche Nachmittag, den man mit Freunden verbracht hat; die ganze Energie ist da drin und das Über-die-Mauer-Schauen auch. Ich glaube nicht, dass ich von Anfang an wusste, dass da ein Baum in der Mitte des Gartens stehen würde. Erst als ich ihn vor mir sah, war es der »Baum der Mitte«. Das nächste Bild war, dass jemand an dem Baum hängt. Und so kam eines aus dem anderen ...
Bevor Joseph über die Mauer steigt, wird er von einem prächtigen Vogel überschattet, der sich auf jenem Baum in der Mitte des Gartens niederlässt. Was hat es mit diesem mysteriösen Vogel auf sich?
Der prächtige Vogel ist gewissermaßen Ausdruck eines starken Affekts, einer mächtigen Emotion. Diesem wunderbaren Wesen will Joseph unbedingt folgen, und so wird er dann in die Handlung hineingezogen. Im Hintergrund dieses Motivs liegt eine jüdische Legende über David, der die Psalmen komponierte. Es heißt, dass ein wunderbarer, mit Smaragden bedeckter Vogel in Davids Gemach auftauchte, während er dichtete. Es soll ein Vogel aus dem Paradies gewesen sein. David sei ihm gefolgt und habe beobachtet, wie er in einen benachbarten Garten fliegt und sich dort auf einem Baum niederlässt. Es war der Garten Bathsebas, die sich dort badete, und David wurde durch jenen Vogel auf sie aufmerksam. Der Vogel ist also ausgesprochen zweideutig: Er ist ein Verführer, aber er ist auch aus dem Paradies – da ist also etwas Göttliches und zugleich etwas potentiell Diabolisches. Wie David erlebt mein Joseph die »Augenpracht« dieses numinosen Vogels, der ihn ansieht und ihn damit schicksalhaft in die Geschichte hineinzieht.
Kommen wir noch einmal zu Ihrer Lesung gerade eben zurück. Mir ist es so gegangen, dass ich – nachdem Sie gelesen hatten – eigentlich gar nichts weiter wissen wollte. Mir hätte der reine Eindruck des Textes und seiner Bilder erst einmal genügt, dem hätte ich gerne weiter nachgehangen. Kennen Sie solche Reaktionen Ihrer Zuhörer?
Ja, ich kenne solche Reaktionen, und sie sind mir sehr wichtig. Was Sie beschreiben ist Ihre Gefühlsreaktion. Wir neigen ja grundsätzlich dazu, die Gefühle wegzudrücken – gerade wir Deutschen haben diese Tendenz, ich stelle das immer wieder fest. Wir wollen gleich zum Sinn durchdringen und zu dem, was wir intellektuell begreifen, verstehen können. Sich den Eindruck noch einmal wachzurufen oder gar die Gefühle, die man hatte beim Zuhören oder Lesen des Textes – das ist etwas, dieses natürliche Bedürfnis ist etwas, was wir geneigt sind, zu unterdrücken, als sei das weniger wichtig. Es ist aber vielleicht das Wichtigste überhaupt.
Würden Sie ein solches Achten auf das Gefühl auch für den Unterricht empfehlen?
Unbedingt. Man sollte, wenn man über Texte spricht, den Schüler oder den jungen Menschen fragen: »War Dir das unangenehm, das zu hören? Oder angenehm? Was für Gedanken hast Du dabei gehabt?« Denn das hält er oder sie ja für völlig unwichtig. Schüler halten sich und ihre Reaktionen ja überhaupt für völlig unwichtig im Vergleich zu dem, was an Lernstoff so durchgenommen wird. Aber wenn man es als Lehrer wagt, dieses scheinbar Unwichtige hineinzubringen, wird man gleich sehen, in welcher Form es vielleicht doch dazugehört. Denn ein bestimmtes Gefühl oder ein Gedanke kam ja tatsächlich dazu, hat sich ja wirklich eingestellt. Wenn man diese innere Dimension in die Auseinandersetzung mit dem Text einbringen kann, dann hat der Schüler, die Schülerin das Wichtigste gelernt: dass es nämlich im Kern um ihn bzw. um sie geht. Dass seine oder ihre Sache hier verhandelt wird.
Was kann denn das Gefühl leisten, was der Verstand nicht leisten kann?
Man kann die Leute sehr oft abholen bei der ersten Gefühlsreaktion, die sonst zu leicht beiseitegeschoben wird. Wir können nämlich oft nicht sofort etwas intellektuell erfassen, wir hätten gern Klarheit, aber wir haben sie eben nicht. Warum? Weil vielleicht etwas anderes, als das, was bereits gewusst wird, gefunden werden soll. Das Ich will ja immer sofort Sicherheit haben. Aber um wirklich etwas zu finden, muss ich erst mal verwirrt sein. Muss ein paar Umwege gehen, muss Unsicherheiten überwinden, muss mich erst auseinandersetzen mit irgendetwas. Wenn ich die Gefühlsdimension akzeptiere, wenn ich sie genau abhöre, hinhöre, dann kann der Prozess eines tieferen Erkennens beginnen.
Sie sprachen vorhin einmal davon, dass Sie als Schriftsteller den Leser »ansprechen « möchten, dass Sie ihn sozusagen »auf den Weg« schicken möchten – wie gelingt Ihnen das?
Ganz egal was ich erzähle – mir ist zunächst einmal wichtig, dass die Spannung, die im Stoff liegt, sichtbar wird. Das heißt: Mein Erzählen muss visuell bleiben. Auch das letztlich Intellektuelle, der abstrakte Gedanke, muss in Bildern dargebracht werden. So wie im Stummfilm damals. Die Handlung wurde in eine Folge von Bildern umgesetzt und dargeboten – es wurde ja nicht gesprochen. Ich frage mich beim Schreiben immer: Wie kann ich das bildlich ausdrücken, bildlich? Diese Sprache ist universell, international, wenn Sie so wollen. Da muss ich nicht diese oder jene Sprache sprechen – ein Bild versteht jeder. Die Sprache, in die ich die Bilder dann fasse, ist stark rhythmisiert. Wenn ich den Text laut lese, werde ich schon allein durch den Rhythmus weitergezogen. Auch wenn vielleicht der Verstand noch ein bisschen hinterherhängt. Der Rhythmus zieht wie ein Magnet weiter. Die Sprache, die ich für die Bilder finde, entspricht oft nicht der Alltagssprache. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, weil ich von Nicht-Alltäglichem wie etwa jenem numinosen Vogel spreche. In gewisser Weise spreche ich von Alltäglichem, denn was ich erzähle, sind Dinge, die alltäglich geschehen, nur bemerken wir sie meistens nicht.
Sie meinen, gerade die nicht alltägliche Sprache würde den Leser ansprechen? Sie müsste aber doch eher fremd auf ihn wirken?
Ja, das könnte man meinen. Aber es ist gerade umgekehrt: Die stark rhythmisierte, mit Inversionen und Wiederholungen durchsetzte Sprache, die unserem Bewusstsein so unvertraut vorkommt, signalisiert dem Unbewussten des Lesers oder Zuhörers: Wir sprechen von dir. Wir sprechen von deinen Stoffen. Wir sprechen von den Bildern, die du uns gibst. Ich vergleiche das oft mit dem französischen Nachbarn, den jemand seit Jahren hat. Mit dem er aber noch nie ein Wort gewechselt hat im Korridor – weil er ja kein Französisch spricht. Aber jetzt können Sie mal ein paar Worte und Sie sprechen den Nachbarn an: »Comment ça va?« oder was auch immer Sie sagen. Und der dreht sich um, sieht Sie zum ersten Mal und denkt natürlich »Oh, das war ja perfekt«. Und fängt sofort an zu plappern. Mit anderen Worten: Das Unbewusste ist der Franzose oder die Französin, die unmittelbar positiv auf solche Ansprache reagieren: »Ach, der spricht ja meine Sprache, der versteht mich ja.« So kann es meinem Leser, meiner Leserin gehen – sie begegnen in meinen Büchern einer Sprache, die ihr Unbewusstes anspricht. Es ist durchaus möglich, dass sie auf eine solche Lektüre hin anders oder angeregter träumen.
Sie haben uns gerade den Schluss von Corpus Christi gelesen. Das letzte Wort des Romans lautet »Hier«, und der Satz endet ohne Punkt, er wird also nicht abgeschlossen. Ist das eine Aufforderung, weiterzulesen und zurückzukehren zum Anfang des Romans?
Also, wenn Sie es so lesen wollen, ja. Genau so habe ich es mir gedacht. Der Prozess hört nie auf – es geht wieder zurück zum Anfang, aber – und das ist entscheidend –: auf einer neuen Ebene. Das »Hier« verweist auf »Hier und Jetzt«. Das heißt: Etwas ist angekommen – Hier. In der Geschichte und beim Leser. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Jetzt schreibt der Leser, der sich in die Geschichte hineinversetzt hat, das Buch in irgendeiner Form weiter. Jetzt beginnt er selbst mit Gedanken, mit Assoziation, mit Gefühlen an der Materie weiterzuarbeiten. Und beginnt vielleicht nochmal von vorn.
Sie schildern in Ihrer Erzählung Meine Reise zu Chaplin, dass Sie als Kind gleichzeitig mit den Figuren im Film waren, dass Sie also in gewisser Weise in deren Welt gelebt haben. Kommt daher Ihre Vorstellung, dass die Buchseite zum Ort eines ähnlichen Erlebnisses für Ihren Leser, Ihre Leserin werden soll?
Nun ja, gute Bücher sind meiner Meinung nach immer Passagen. Wie gute Filme. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einem Film, der Sie sehr beeindruckt, der Sie aufgewühlt hat. Was ist da anderes frei geworden als eben eine Passage zu Ihnen, zu Ihren Gefühlen, die ja offensichtlich damit zu tun haben, denn die sind ja beim Lesen aktiviert worden? Diese Gefühle waren im Übrigen vorher schon da – sie wurden nur wiedergefunden. Der Film oder das Buch hätte also letztlich nur freigesetzt, was wartend schon in Ihnen war. Und was jetzt antwortet. Dieses Bild vom Buch als einem Passagenbereiter – das ist für mich essenziell. Die Vorstellung vom Buch als etwas Abgeschlossenem, das für sich steht, interessiert mich nicht. Ein Buch muss einen Schacht freilegen im Leser, so dass er diesen Schacht benutzen oder ihn weitergraben kann. Das Wort »Schacht« impliziert ja schon, dass es hier um Dinge geht, die nicht unbedingt an der Oberfläche liegen. Das Ziel ist, in eine Schicht vorzudringen, wo die tieferen, die heftigeren Emotionen residieren. Dort sind auch die zeitlosen, die archetypischen Bilder zu finden, auf die es mir beim Schreiben ankommt.
Patrick Roth liest
Magdalena am Grab
11. April 2009, Celle
Die Magdalenensekunde
Eckhard Nordhofen
erschienen in Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 11.04.2004
Weil Christus, den sie kannte, nun der Herr der Welten ist.
Zu Patrick Roths Erzählung "Magdalena am Grab"
Präsenz Gottes im Menschenfleisch, der Mensch als ein Gottesmedium: Das ist die Botschaft von Weihnachten. Aber mit dem ganzen Christentum wäre es nichts, wenn es keine Antwort auf die Sterblichkeit dieses Fleisches geben könnte. Die Antwort gibt Ostern, das die Wirklichkeit des Fleisches durch eine größere Realität einrahmt. Was ist es, das uns überdauern kann? Sind es "geistige Realitäten", die Seele oder die Erinnerung an eine Lehre? Für die materialistische Moderne ist das Geistige eine zweite Realität: Das Sein bestimmt das Bewußtsein. Johannes, der Evangelist der Inkarnation, verkündet die Einheit von Geist und Fleisch. Aber die Auferstehung des Fleisches ist nicht die Rückkehr in die alten Koordinaten.
Der deutsche Schriftsteller Patrick Roth hat im Johannesevangelium eine bemerkenswerte Ungereimtheit entdeckt. Er erzählt, verpackt in die Novelle Magdalena am Grab, wie er eine solche Entdeckung gemacht hat. Das Ganze spielt vor zwanzig Jahren in Los Angeles, im Weichbild von Hollywood, am Mullholland Drive, wo sich der Cineast Roth als Schauspieler und Drehbuchautor ausbilden läßt. In der Schauspielschule sind Verrücktheiten erlaubt, niemand lacht, als sich Roth bei seiner Fingerübung in der Kunst des Dramatisierens auf den Ostermorgen kapriziert, genau so, wie ihn der Text des Evangelisten Johannes schildert.
Petrus und "der Jünger, den Jesus liebte", waren um die Wette zum Grab gelaufen. Im Johannesevangelium ist natürlich Johannes der Gewinner des Wettlaufs, der erste nach Maria aus Magdala, der Entdeckerin, der ersten Zeugin. Maria Magdalena hatte es noch in der morgendlichen Dunkelheit dorthin gezogen. Sie entdeckt, daß der Stein weg war, der die Kammer verschlossen hatte, läuft mit der Nachricht zu den beiden. Petrus und Johannes rennen zum Grab, gehen hinein, sehen die zusammengeworfenen Leichentücher, und wieder ist es der "andere Jünger", von dem es heißt: "Er sah und glaubte." An dieser Stelle setzt die Regiearbeit des Ich-Erzählers ein. Es geht um die Szene, die nun folgt: Maria Magdalena ist noch einmal zurückgekehrt. Jetzt steht sie alleine am Grab. Sie weint.
Patrick Roth organisiert die Ereignisse auf mehreren Ebenen, blendet die Zeiten übereinander. Das Mädchen, das die Rolle der Magdalena übernimmt, ist von Rätseln umwittert, Monica, eine schöne Italienerin, die ihre Adresse nicht rausrückt, hinter der der Ich-Erzähler herfährt und deren geheimnisvoller Hintergrund für Spannung sorgt. Diese Monica Esposito spielt die Maria aus Magdala, und als Magdalena macht sie eine Entdeckung. In ihrer Rolle entdeckt sie die verborgene Pointe des Textes. Sie entdeckt die Entdeckung von Ostern. Magdalena, so steht es im Text, dreht sich um - und zwar einmal zuviel. Warum muß sich Maria Magdalena zweimal umdrehen?
Es handelt sich um eine der anrührendsten und zartesten Szenen im Neuen Testament. Die Frau, die Jesus auch im Tod nicht verlassen hat, kennen wir gut von tausend Bildern aus zwanzig Jahrhunderten: wie sie mit Johannes und Maria, der Mutter, unter dem Kreuz steht und weint, die Frau, die Jesus ins Sterben hinein begleitet hat, bei ihm geblieben war, vielleicht geholfen hat, ihn ins Grab zu legen. Nun steht sie wieder dort. Zuerst bleibt sie draußen und weint. Dann beugt sie sich vor und sieht hinein. In der Kammer sieht sie zwei Engel sitzen, einen dort, wo das Haupt, und einen dort, wo die Füße des Leichnams gelegen haben, und sie sprechen mit ihr: "Warum weinst du?" Maria: "Man hat meinen Herrn weggenommen." Dann dreht sie sich zum ersten Mal um. Hinter ihr steht eine Gestalt.
Patrick Roth ist auf Genauigkeit aus: Die Grabkammern zeigen nach Osten, und es ist früher Morgen, also schaut sie gegen die aufgehende Sonne, die Gestalt, der Maria sich zuwendet, ist nur als Silhouette zu sehen. Es ist wohl ein Gärtner, Magdalena fragt ihn: "Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen." Was nun folgt, nennt Roth die "Magdalenensekunde". Ausgelöst wird er durch ein Wort, das die Gestalt spricht: "Mariam." Sie wird bei ihrem Namen gerufen. Blitzartiges Wiedererkennen - ein Augenblick höchster Nähe. Es ist Jesus. Stop! Monica hat Schwierigkeiten. Der Text verlangt, daß sie sich nochmals umdreht, auf dem Höhepunkt wegdreht. Warum?
Wir lassen hier weg, was in der kalifornischen Schauspielschule an dieser Stelle geschieht, das muß bei Roth nachgelesen werden. Konzentrieren wir uns auf den Text, den es umzusetzen gilt, und sein Rätsel. Er ist wirklich selbst schon dramatisch genug. Was sagt die deutsche Einheitsübersetzung? "Da wandte sie sich ihm zu." Aber warum soll sie sich ihm noch einmal zuwenden? Zwei Verse zuvor hatte sie sich dem "Gärtner" doch schon zugewandt. Wir müssen im griechischen Originaltext nachschauen. Da steht "strapheisa". Das ist ein Aorist, wörtlich: "sich umgedreht habend". "Ihm zu" steht nicht da. Luther übersetzt korrekt: "Da wandte sie sich um und spricht zu ihm ,Rabbuni'." Dieser hebräische Ausdruck steigert die normale Anrede "Rabbi". In der jüdischen Literatur wird "Rabbuni", das "Lehrer" oder "Meister" heißt, auch für Gott verwendet. Es ist nicht so, als sei den wissenschaftlichen Exegeten die "unnötige" Drehung nicht aufgefallen. Aber sie registrieren sie als eine der Ungereimtheiten, die der Bibeltext aufgrund von Überarbeitungen nun einmal enthält.
Patrick Roth ist wahrlich nicht der erste, der biblische Szenen nachinszeniert. Ignatius von Loyola regt schon in seinen Exerzitien dazu an, sich die biblischen Schauplätze vor dem inneren Auge aufzubauen und Schritt für Schritt die Szenerie durch Imagination zu verlebendigen. Religionspädagogen lassen ihre Schüler biblische Szenen nachstellen und nachspielen, Oberammergau tut es, Mel Gibson tut es. Nun aber entdeckt auch die wissenschaftliche Exegese die Lehr--Performance, die bedeutungsträchtige Inszenierung, eine Art Handlungs- und Faktensprache, die dem Text als zweite Sprache unterlegt ist und die er dann nacherzählt. Die Ereignisse werden nicht erzählt, um etwas Geschehenes im Text noch einmal abzubilden, sie werden erzählt, damit sie Bedeutung erzeugen, damit sie sprechen.
Warum kann Monica nicht weiterspielen? Warum wendet sich Magdalena um? Patrick Roth wird hier zum Hilfsevangelisten, ergänzt einen Satz, läßt Magdalena erst einmal an Jesus vorbeigehen, damit es einen Sinn bekommt, daß sie sich wieder umdreht. Roth ist Dichter, er darf das. Aber wie, wenn wir ohne alle dichterischen Hinzufügungen und redaktionsgeschichtlichen Glättungen auskämen? Wie, wenn der Text, so wie er da steht, schon einen Sinn hätte? Und er hat einen Sinn, einen besonders tiefen.
Wir haben es mit Johannes zu tun. Dieser Evangelist verfolgt ein ungeheures Ziel: Er will, daß seine Leser erkennen, daß der Geist Gottes im Menschenfleisch ganz präsent geworden ist. Dieser Mensch ist für ihn Jesus, der im jüdischen Volk erwartete Messias. Die dramatische Spannung entsteht, weil er den historischen Jesus möglichst nahe an den Leser heranrückt und dennoch bezeugt, daß dieser Mensch das Fleisch gewordene Wort Gottes, der Sohn, Gott im Fleisch gewesen ist. So formuliert es seine berühmte Prägung aus dem Prolog: Jesus "ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen" (1,14).
Um die Ungeheuerlichkeit dieser Behauptung zu ermessen, müssen wir uns vergegenwärtigen, wer der Gott Israels ist. Wir haben es nicht mit einer dieser hellenistischen Gottheiten zu tun, zu deren Vergnügungen es gehört, gelegentlich in Menschengestalt zu erscheinen, etwa so, wie der abenteuerlustige Zeus in Gestalt des Amphytrion auftritt. Der Gott des alten Israel ist nichts weniger als der Hintergrund des Seins, der Schöpfer der Welt, der Gesetzgeber vom Sinai, der Unsichtbare, den man nicht anschauen darf. Johannes weiß das. Er formuliert: "Keiner hat Gott je gesehen" (1,18). Im Buch Exodus des Alten Testaments verhüllt Mose sein Gesicht, als er die Stimme aus dem brennenden Dornbusch hört, "denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen". Und später (33,20) heißt es: "Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben." Gott kann nicht angeschaut werden. Wenn er sich bemerkbar macht, schickt er seine Medien, die Engel. Und regelmäßig befällt die Menschen Furcht. Regelmäßig beginnen die Erscheinungserzählungen mit dem "fürchtet Euch nicht", das wir aus der Weihnachtsgeschichte des Lukas kennen, wo der Engel die Hirten mit diesen Worten begrüßt.
Und nun Magdalena. Wen sieht sie? Sie sieht den, dessen grauenhaften Tod sie miterlebt hat. Er ist es, aber wer ist er jetzt? Sie erkennt ihn wieder, aber in der Magdalenensekunde erkennt sie auch, wer er wirklich ist, Rabbuni, der auferstandene Herr der Welten, der Sohn Gottes, Gott selbst. Johannes will seinen Lesern Magdalenas blitzartige Erkenntnis klarmachen, daß Jesus Gott ist. Und darum wendet sie sich ab. Sie muß sich abwenden, denn: "Keiner hat Gott je gesehen." Es geht um den Unterschied des Vorher und Nachher. Jesus ist nicht einfach wieder lebendig geworden und derselbe, der er vor seinem Tod gewesen war. Er ist ein anderer. Diese Differenz arbeitet der Text heraus. Der Gedanke wird noch durch jenes berühmte "noli me tangere" verstärkt: "Berühre mich nicht!" Nicht ansehen und nicht anfassen, nicht jetzt, nicht in diesem Leben. "Dann aber", wird Paulus im ersten Korintherbrief schreiben, "schauen wir von Angesicht zu Angesicht" (13,12).
Zu der Komposition des Textes gehört auch die folgende Gegengeschichte. Da macht einer die Berührung zur Bedingung des Glaubens: "Wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht." Aber der ungläubige Thomas wird durch das Angebot Jesu beschämt: "Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite." Caravaggio hat die Szene in den Skandal verlängert. Die Art und Weise, wie er Thomas die Finger in die geöffnete Wunde stecken läßt, hat etwas eklig Blasphemisches. Wir verstehen sofort die Absurdität eines empirischen Gottesbeweises. Im Text kommt es nicht soweit. Hier stammelt der Beschämte nur: "Mein Herr und mein Gott!" Und am Ende mündet alles in den Satz: "Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben."
Mehr über Patrick Roth im Eulenfisch


Jochen Ring: Der fremde Reiter
Eulenfisch 01_2018: "Arbeit und Kapital"
Die Kultivierung des Erinnerns spielt in Erzählgemeinschaften wie dem Christentum eine besondere Rolle. Patrick Roths Geschichtsphilosophie zeigt, wie aktive Aneignung und Transformation von Geschichte Neues bewirkt.
zum Beitrag
Thomas Menges: Freudenmahl im himmlischen Jerusalem
Eulenfisch 01_2018: "Arbeit und Kapital"
Die Malerin Marie-Luise Reis lässt sich durch den Schriftsteller Patrick Roth zu einem neuen Bildmotiv anregen
zum Beitrag
Helmut Müller: Auferstehung erfahren
Eulenfisch 01_2018: "Arbeit und Kapital"
2017 erschienen die drei Christuserzählungen Patrick Roths erstmals kommentiert in einem Band. Damit kam zusammen, was zusammengehört: Eine sprach- und bildgewaltige Brücke in die ungeheuerlichste Geschichte der Menschheit.
zum Beitrag
Rezension: Patrick Roth - "Die Christus Trilogie"
Eulenfisch Literaturmagazin 01_2018
von Michael Braun
zum Beitrag
Eckhard Nordhofen: Vor der Schrift kamen die Träume
Eulenfisch 01_2012: "Klöster: Kolonien des Himmels"
Ein spannender Plot nach allen Regeln orientalischer Erzählkunst. Patrick Roths neuer Roman "Sunrise" fügt der Bibel neue Geschichten hinzu.
zum Beitrag
Limburger Impulse zur Religionspädagogik
Band 6
Literatur, Religion und einige letzte Fragen
Patrick Roth - Sunrise. Das Buch Joseph.
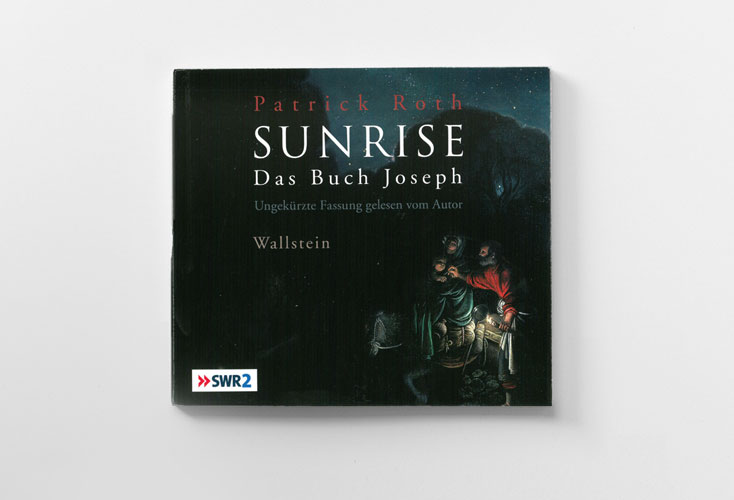
Patrick Roth liest "Sunrise. Das Buch Jospeh"
Höhrbuch. Ungekürzte Fassung
in Kooperatin mit SWR2
MP3-CD / zwei CDs / 930 Minuten
zur Bestellung
