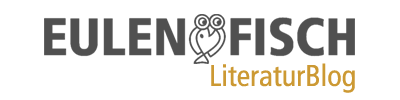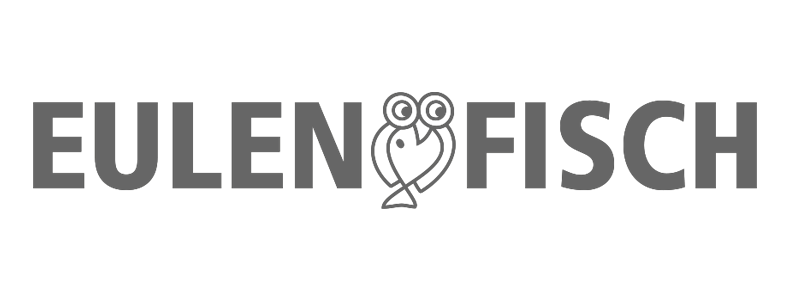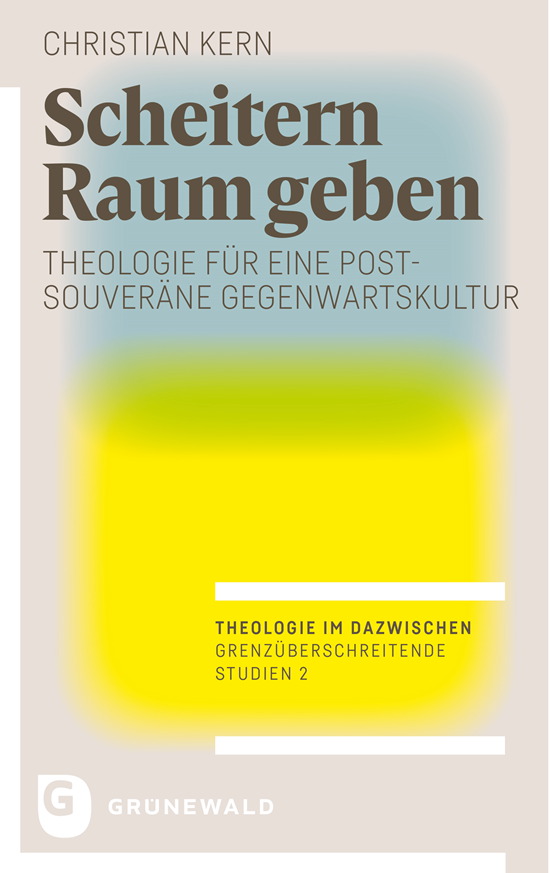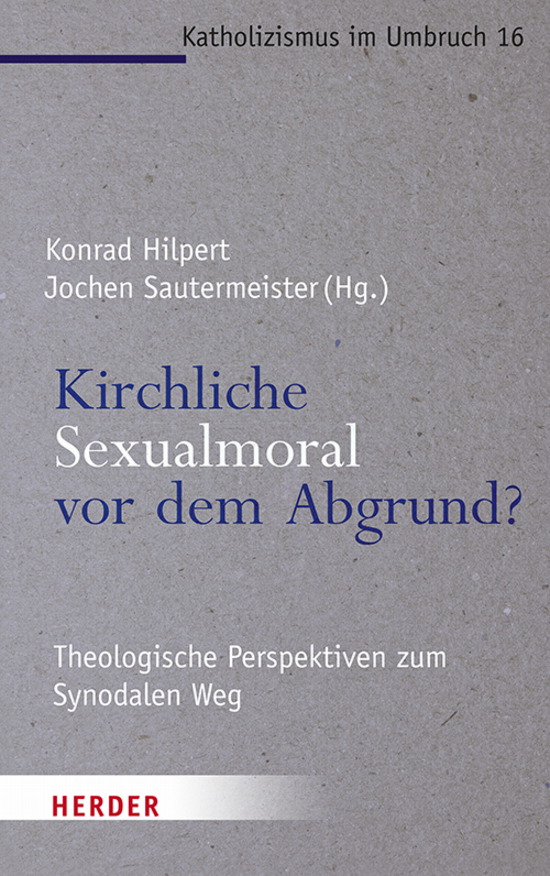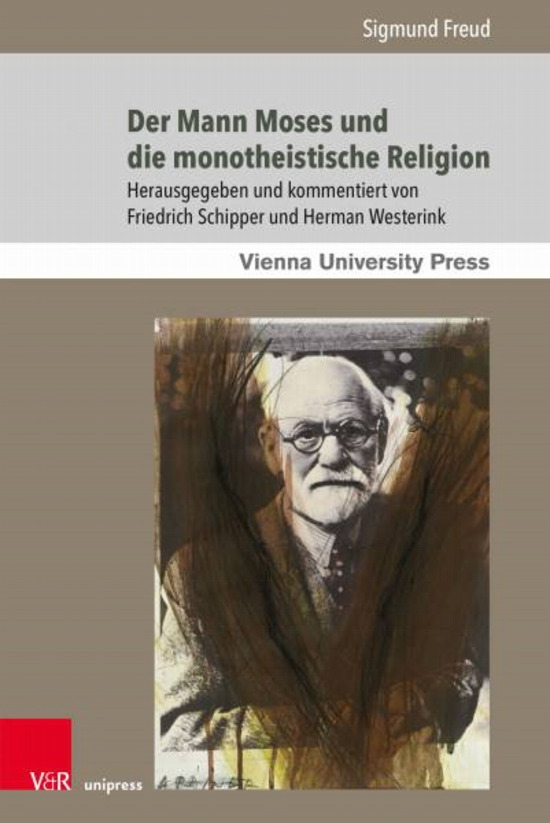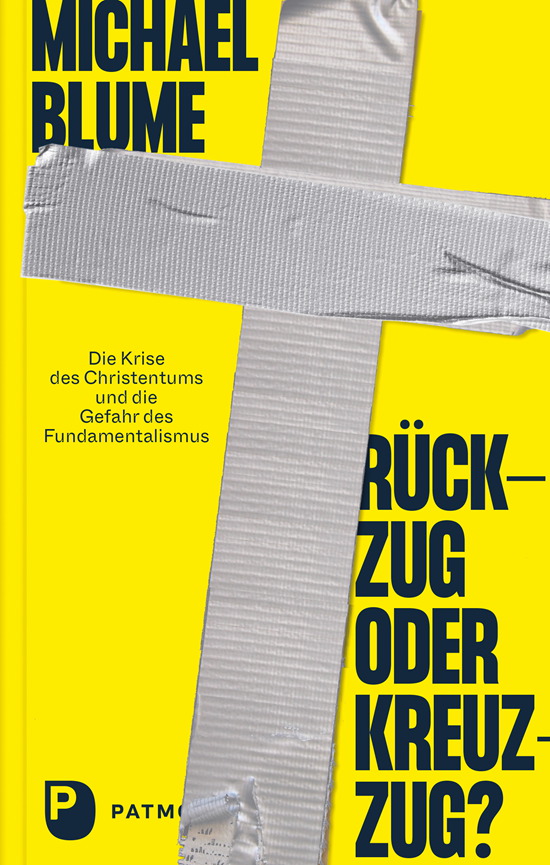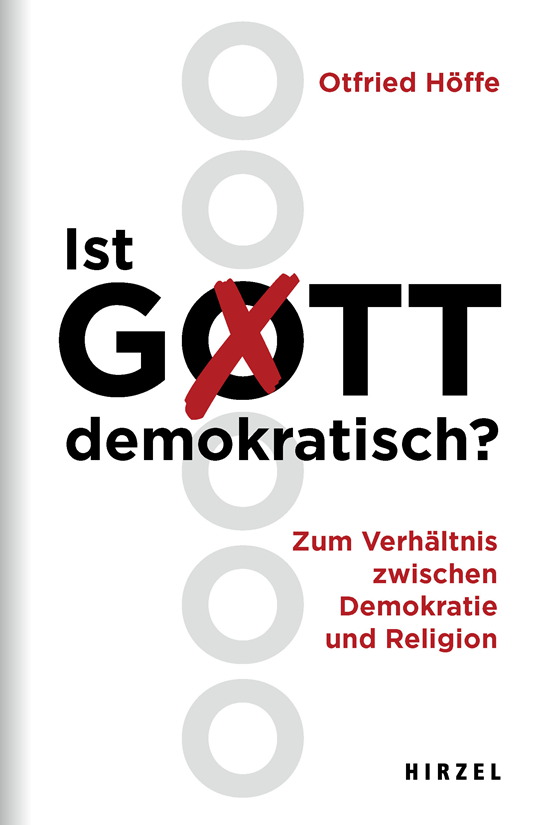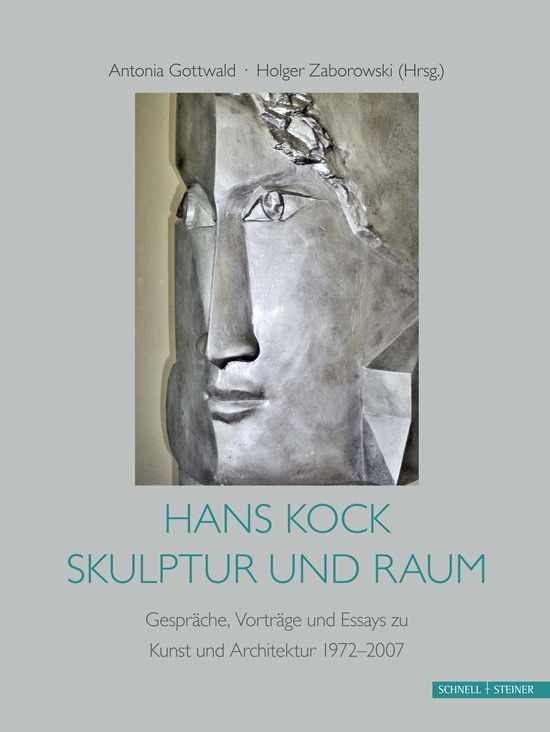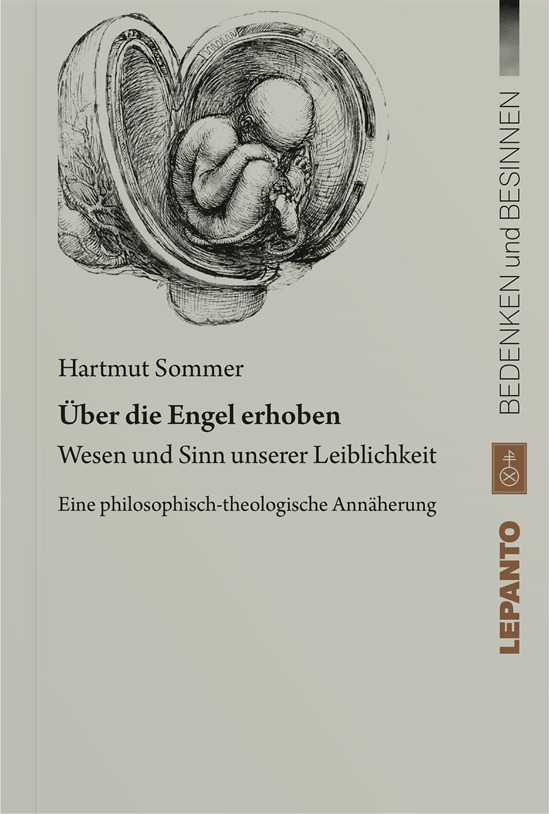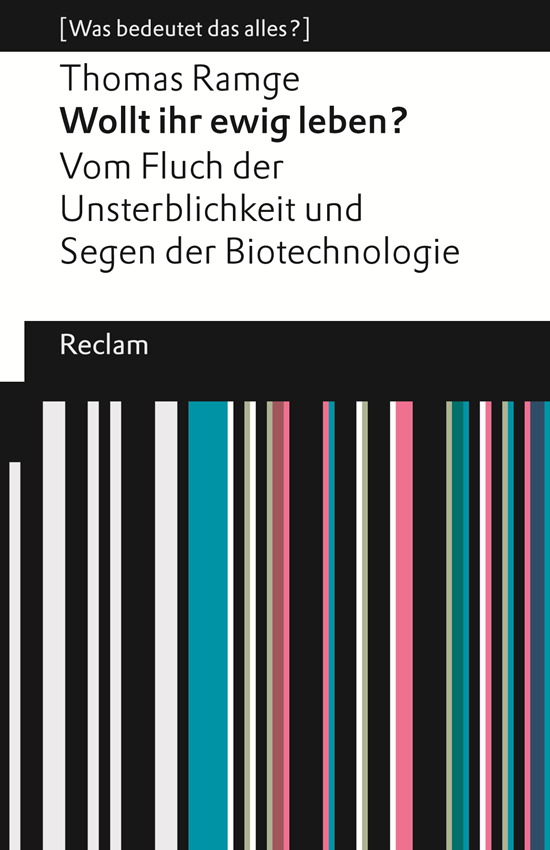Was hat die Havarie der Costa Concordia am 13. Januar 2012 mit der Theologie zu tun. Kurz und bündig gesprochen: das Scheitern und wie dieses in Sprache gefasst wird. So wird im vorliegenden Buch, der überarbeiteten Doktorarbeit von Christian Kern, die Analyse des Schiffbruchs eines Kreuzfahrtschiffs im Mittelmeer mit der biblischen Erfahrung des Ostermorgens in Beziehung gesetzt. Wie gelingt angesichts des Scheiterns menschliches Leben und was besagt dies über die Rede von Gott? Dazwischen liegen interessante und spannende Auseinandersetzungen über die Frage, was unsere Kultur kennzeichnet: souveräne Positionen des Erfolgs oder Lebensgestaltung in Fragilität angesichts von Scheitern.
Das Wort „scheitern“ stammt ursprünglich aus dem maritimen Kontext als einer wenn auch in der Schifffahrt...