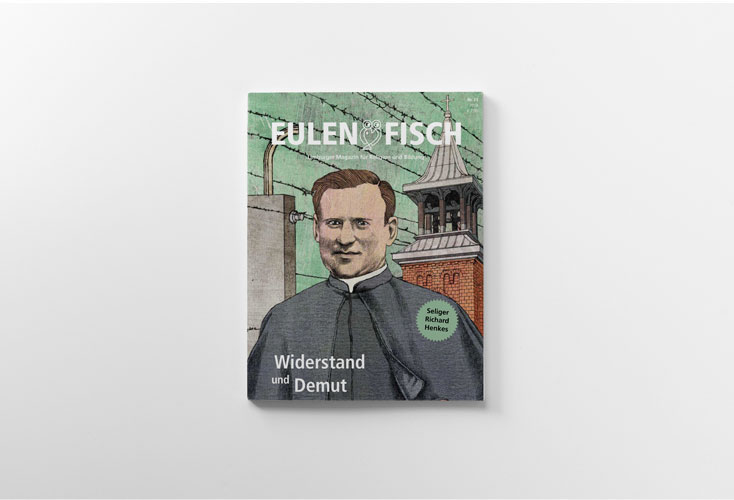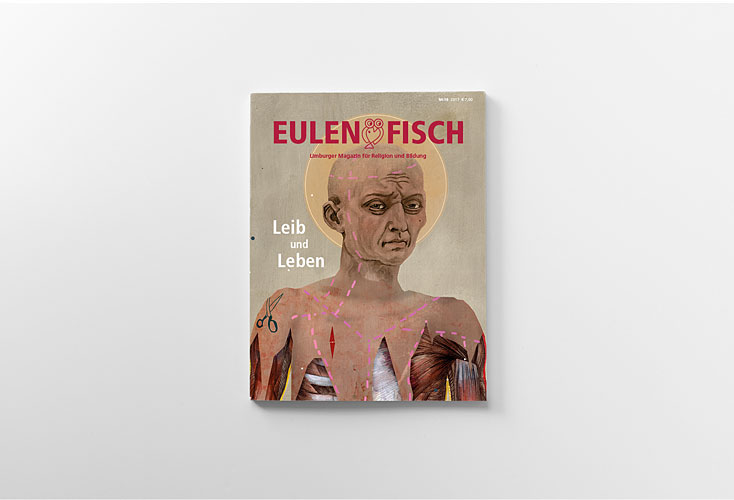Zur Berufung berufen sein
Der Ruf Gottes ist ein Ruf der Liebe. Er ereignet sich im Zwiegespräch zwischen Gott und Mensch. So vielfältig wie die Geschichten Gottes mit den Menschen, so vielfältig sind auch die Gesichter der Berufung
Krise(n) der Berufungen
Es gibt Worte, die keine Fremdworte sind
und die ganz vertraut klingen – so, als
könnte man sofort wissen, was mit ihnen gemeint
ist –, die aber trotzdem fremd wirken.
Manchmal sind einzelne Aspekte ihrer Bedeutung
einem noch bewusst. Nicht selten
ist nur eine ferne Ahnung geblieben. Gelegentlich
bleibt nur noch ein bloßer Verdacht.
Was sie zum Ausdruck bringen, ist nicht
mehr selbstverständlich. Wie Ruinen erinnern
sie an vergangene Zeiten. Man konnte
einmal in diesen Häusern wohnen. Ja, vielleicht
lebte es sich nicht schlecht in ihnen.
Aber heute schlägt man lieber anderswo
Quartier auf.
Auch »Berufung« gehört zu diesen Worten,
die aus einer anderen Zeit heraus in die Gegenwart
sprechen. Nur selten noch wird von
einer »Berufung« gesprochen. Kritisch merkt
man hin und wieder an, dass sich jemand
zu etwas Höherem berufen fühlt. Immer
noch hört man zwar etwas aus »berufenem
Munde«. Weit seltener ist es geworden, dass
jemand bekennt, er sei zu etwas berufen.
Man ist eher aktiv an etwas interessiert oder
engagiert sich, als dass man sich zu etwas
berufen lässt – oder zumindest das Gefühl
hat, man sei berufen. Müsste man sich nicht
wenigstens im Vorfeld selbst bewerben oder
zumindest Interesse signalisieren, einem
Ruf auch zu folgen? Eine Berufung kann
doch nicht einfach so ergehen, ohne dass
man selbst aktiv geworden wäre. Der Beruf,
zu dem man ja – dank Luther – auch berufen
ist, ist so zu etwas geworden, was man aus
eigenem Antrieb heraus wählen, auf Wunsch
wechseln und bei mangelndem Interesse
aufgeben kann.
Auch in kirchlichen Kreisen hat die »Berufung
« ihre Selbstverständlichkeit eingebüßt.
Man stellt im Geist technokratisch geführter
Statistiken Jahr für Jahr fest, dass
die Zahl der Berufungen abnimmt – als sei
»Berufung« etwas, das man wie Äpfel abzählen
kann und dessen Gesamtzahl zu- oder
abnimmt. Es gibt noch die »Berufungspastoral
«, die sich an alle richtet, die sich für Berufe (in) der Kirche interessieren. Berufen ist
man nämlich nicht nur zum Priesterstand
oder Ordensleben, sondern zum kirchlichen
Beruf. Doch letztlich ist jeder Christ zum
christlichen Leben berufen. Allerdings kann
auch diese wichtige Vertiefung von »Berufung
« – angeregt nicht zuletzt durch das
Zweite Vatikanische Konzil – nicht darüber
hinwegtäuschen, dass man auch innerkirchlich
– unter den Gläubigen, aber auch seitens
offizieller Stellen – mit der »Berufung«
zu fremdeln scheint.
»Berufung kann zu einem
Vorwand werden«
In einer Welt der Selbstbestimmung, der
vielfältigen Handlungsoptionen und der Optimierung
der Lebensläufe wirkt die Rede
von einer »Berufung« nämlich wie ein Fremdkörper.
Ist Berufung unter diesen Vorzeichen
nicht nur als Selbstberufung denkbar?
Doch kann man sich selbst berufen? Schon
sprachlich ist dies nicht möglich. Man kann
sich auf etwas berufen oder wird von jemandem
berufen. Aus der Berufung lässt sich
die Bezogenheit auf etwas anderes nicht
herausstreichen. Es ist zudem Gott selbst,
der im engeren, christlichen Sinne beruft.
Wie aber sollte das vor sich gehen? Selbst
wer an Gott glaubt, mag Zweifel an der Möglichkeit
eines berufenden Gottes hegen. Wie
könnte dieser Ruf erfahrbar sein? Erfährt
man ihn in der Bibel? Bedient er sich anderer
Menschen? Macht er sich an bestimmten
Naturereignissen fest? Erklingt er innerlich
– als Stimme des Gewissens? Wie lässt es
sich verstehen, dass Gott diesen Menschen
hier beruft und andere nicht? Verletzt eine
Berufung nicht die Freiheit des Menschen?
Kann, wer berufen ist, noch in voller Freiheit
handeln? Und selbst wenn eine solche
Berufung sich hier und da ereignet, so stellt
sich die Frage, ob die Rede von einer göttlichen
»Berufung« nicht zu privat, zu intim
ist, als dass sie den Blick der Öffentlichkeit
vertrüge. Ist die Rede von »Berufung« nicht allzu indiskret? Muss nicht jeder mit seiner Berufung
selbst fertig werden? Kann man sie vielleicht nur wenigen
anderen Menschen mitteilen? Und weiter: Wenn
ohnehin alle berufen sind, worin liegt dann noch die
Bedeutung besonderer Berufungen? Widersprechen
diese nicht den egalitären Vorlieben demokratischer
Gesellschaften, die allen die gleichen Rechte und
Chancen zusprechen? Darf der Herr es dem Einen im
Schlaf geben und die anderen leer ausgehen lassen?
Man sieht, dass, wer einmal anfängt, über »Berufung
« nachzudenken, sich in allerlei Problemen verheddert.
Die Probleme erweitern sich noch, wenn man
sich die Wirklichkeit so mancher Berufung – sprich:
so mancher berufener Menschen oder, besser noch,
so mancher sich berufen wähnender Menschen – anschaut.
In »Berufung« klingt noch die Besonderheit
einer Auszeichnung, eines Ehrentitels nach. Doch gerade
solche ehrenvollen Attribute maßen sich gerne
– nicht nur in religiösen Kontexten – jene an, die in
Wahrheit nicht berufen sind, sondern die berufen sein
wollen. Und so kann man sich zu allem Möglichen –
und Unmöglichen – berufen fühlen. Berufung kann
zu einem Vorwand werden, zu einer Illusion oder im
schlimmsten Fall zu einer Pathologie. Es gibt die Berufung
der Hochstapler, die Berufungsanmaßung, die
Berufung aus Eitelkeit und Narzissmus. Die Rede von
einer »Berufung« von außen verdeckt dann den eigenen
Willen – zur Macht, zum Glanz, zur Verherrlichung
des eigenen Selbst.
Entschiedenheit der Berufungen
Angesichts dieser Krise(n) der Berufungen könnte man
verführt sein, auf die »Berufung« zu verzichten, andere
Worte zu suchen, anders von dem, was gemeint ist,
was »Berufung« bedeuten könnte, zu sprechen. Ohne
Frage gilt es, immer wieder den Glauben – und mit ihm
die Grundworte des Glaubens – ins Heute zu übersetzen,
erstarrte Formeln aufzubrechen, neue Worte zu
finden. Aber um überhaupt zu übersetzen, muss man
vermitteln können. Ein Übersetzer muss sich in zwei
Sprachen und ihren Spielen bestens auskennen. So
kommt der Versuch der Übersetzung nicht daran vorbei,
die Frage, was mit »Berufung« eigentlich gemeint
ist, zu stellen. Was also ist dies – Berufung? Wie genau
geht das – berufen zu werden?
Schon aus einer nicht-religiösen Perspektive muss
man die Frage nach der Berufung, die man hat, stellen.
Denn unsere Existenz ist zutiefst flüchtig. Was
hat Bestand? Woran lässt sich festhalten? Wo findet
sich Heimat? Welche der vielen möglichen Wege können
beschritten werden? Was soll man mit sich anfangen?
Wie, wozu, woraufhin soll man leben? Das
sind letztlich Fragen nach der Berufung, die man
hat. Aus einer christlichen Perspektive verschärfen
sich diese Fragen noch. Denn sie verbinden sich mit
Fragen, die wir kaum noch zu stellen wagen: Was ist
die Absicht, der Plan Gottes? Was hast Du, Gott, mit
mir vor? Wer bin ich – vor Dir, Gott, meinem Schöpfer
und Erlöser? Wer soll ich sein? Was also bedeutet es
aus christlicher Sicht, im Glauben an den Gott, der in
Christus sein Antlitz zeigt, berufen zu sein? Was bedeutet
es, dass die Person Jesus in ihrer Freiheit und
ihrem Gehorsam Gott gegenüber, in ihrer Gottes- und
Menschennähe, in ihrer Autorität und auch in ihrer
Gottesverlassenheit Urbild und Vorbild einer jeden
christlichen Berufung ist?
»Berufen ist man nie alleine«
Die zunächst so unscheinbare, so spezielle Frage
nach der Berufung zielt nicht auf etwas Nebensächliches,
sondern mitten ins Zentrum des Glaubens. Wo
von Berufung die Rede ist, geht es nämlich ums Große
und Ganze. Eigentlich müsste man dies noch radikaler
formulieren: Ohne Berufung(en) ist nicht einfach
die »Mitte« des Glaubens leer oder mit etwas anderem
gefüllt. Es gibt ohne Berufung keinen Glauben. Denn
auch wenn man den Glauben als Geschenk oder Gnade
erfährt, auch wenn man in den Glauben hineinwächst,
wenn man ihn von seiner Familie, seinen Freunden
oder der Kirche »mitbekommt« – irgendwie, irgendwann
–, wird man sich einmal zum Glauben verhalten
und entscheiden müssen. Irgendwann wird und
muss der Glaube, der mir mitgegeben oder geschenkt
wurde, persönlich, zu meinem Glauben werden, betrifft
mich in meiner Freiheit, wird zu meiner Frage
von Ja oder Nein. Glaube ich an Gott? Widersage ich
dem Bösen? Versuche ich mich in der Liebe? Folge ich Christus in seinem Von-Gott-Berufensein
nach? Anerkenne ich, dass ich selbst auch
berufen bin – zum Glauben, ja, zur Berufung
des Glaubens? Bei diesen Fragen kann man
sich nicht auf andere verlassen. Man kann
sich nicht vertreten lassen, man muss etwas
sagen – so oder so. Berufung ist nämlich kein
Monolog, kein Befehl Gottes, der an mich ergeht
und dem ich blind zu folgen hätte. Was
wäre das für ein Gott? Ein himmlischer General?
Ein ewiger Diktator? Nein, wo auch
immer ein solcher Gott zu berufen scheint –
ist es nicht Gott, der ruft, sondern ein Götze,
ein Idol, das wir uns selbst gemacht haben.
Gott will keinen blinden Gehorsam, keine
Antwort auf seinen oft so überraschenden
Ruf aus äußerem Zwang, aus bloßer Gewohnheit
oder reiner Gefälligkeit, sondern
aus Freiheit heraus. Man muss und kann
nicht immer alles verstehen, wozu Gott einen
beruft. Gott kann einen überwältigen.
Man kann aber aus Freiheit heraus vertrauen,
dass gut ist, was geschieht. Eine echte,
aus dem Herzen kommende Ergebenheit an
den Willen Gottes schließt den freien Willen
nicht aus. Wer Gottes Ruf folgt, wer ihm
vertraut und sich auf ihn einlässt, wird jedoch
auch immer wieder im Zweifel stehen,
immer wieder Unsicherheiten verspüren,
immer wieder angefochten sein. Die Anerkennung
der eigenen Berufung ist, wie jeder
Akt der Freiheit, ein Wagnis. Viel steht auf
dem Spiel. Der Einsatz ist die ganze Person.
Verlangt ist Mut zur Entschiedenheit, Offenheit
für Überraschungen, Bereitschaft zum
Neuen und Gehorsam, der in der betenden
Zwiesprache mit Gott wurzelt, ein Gehorchen,
das vom Hören kommt: auf jenes Wort,
das Gott an mich richtet, auch wenn ich nie
damit gerechnet hätte.
Diese Entschiedenheit des Glaubens ist
ein entscheidendes Fundament der Kirche.
Denn Kirche ist ekklesia, Gemeinschaft der –
so die Übersetzung des griechischen Wortes
für Kirche, das sich in der Antike auf die Volksversammlung bezog – »Heraus-« oder »Zusammengerufenen
«, Gemeinschaft derjenigen also, die
den Ruf Gottes hören, ihn anerkennen und nach ihm
leben, denken und handeln. Diese kirchliche Dimension
der Berufung bedeutet auch: Berufen ist man, so
sehr sie eine Frage an die eigene Freiheit formuliert,
nie alleine, sondern mit Anderen – und insofern auch
für andere Menschen und von anderen Menschen her.
Berufung ist kein isoliertes oder isolierbares Ereignis
der eigenen Biographie, sondern immer ein soziales
Geschehen. Sie ist – von Gott her und auf ihn hin –
eingebettet in die Welt der Mitmenschen.
Eine Berufung verlangt oft kein spektakuläres Tun,
keine große Aktion, sondern etwas ganz Einfaches:
sich zu »präsentieren«. Die Antwort, die viele Berufene
in der Bibel und in der Geschichte der Kirche
auf den Ruf Gottes gegeben haben, lautete: »Hier bin
ich!« Wenn ich so auf eine Berufung, den göttlichen
Ruf antworte, werde ich für Gott gegenwärtig. Nicht,
dass ich zuvor für Gott nicht existiert hätte. Aber
nun antworte ich – als angesprochene Freiheit, als
Subjekt – und trete, als sprechende Person, als Partner
in einem Dialog – in eine vertiefte Gemeinschaft,
eine besondere Beziehung mit Gott ein. Gott hat sich
– im Ruf – geäußert. Er ist nach außen getreten und
mir nahegekommen, ohne dass ich das hätte (vorher-)
bestimmen können. Plötzlich war da etwas. Und
weil Gott mich angerufen und berufen hat, kann ich
meine Stimme erheben und mich meinerseits auf ihn
einstimmen. Berufung, das ist Zwiesprache zwischen
Gott und Mensch.
»Wo von Berufung
die Rede ist,
geht es ums Große und Ganze«
In der Berufung ist etwas an mir geschehen; mir ist
etwas widerfahren. Aus dieser Ohnmacht heraus kann
neue Macht erwachsen. Das ist die Erfahrung vieler
Berufener: Aus der Passivität wird Aktivität; die Verwundbarkeit
des Berufenen wandelt sich in Kraft und Stärke; der Anspruch, der ergangen ist, wird
zu einer Quelle der Freiheit. Die Berufung ist
eine Erfahrung, die es möglich und notwendig
macht, dass ich mich vor Gott verorte:
»Hier bin ich!« Der Raum, der sich in der
Berufung und in der Antwort auf diesen Anspruch
eröffnet, schenkt Identität. Das »Hier
bin ich!« bestimmt, wer ich bin, weil Gott
mir immer schon zusagt, wer ich – wirklich,
letztlich, vor ihm und vor den Menschen –
sein soll. Im Angesicht Gottes werde ich
durch seinen Ruf und Blick zu einem neuen,
zu einem angesprochenen, gerufenen und
berufenen Ich. In der Berufung scheidet sich
somit ein altes von einem neuen Ich. Dies ist
ohne Wandel, ohne Umwandlung und Konversion
nicht zu denken – geschweige denn
zu erfahren.
Wer sich so erfährt – angesprochen, herausgefordert,
berufen –, wird daher anders
leben. Berufen zu sein, ist mit einer
bestimmten Lebensweise verbunden. Denn
der Ruf Gottes ist ein Ruf der Liebe und ein
Ruf zur Liebe. Gott beruft den Menschen,
den er liebt, weil er ihn liebt. Und damit dieser
selbst liebt. Daher ist die Existenz des
Berufenen – »Hier, bin ich!« – immer relational
und bezogen: auf Andere hin, für Andere,
von Anderen her. Im Ruf wird die eigene
Existenz als Gabe erfahren: vom rufenden
Gott her und auf den Nächsten hin.
Von der Berufung her, im Lichte des göttlichen
Blicks, im Anspruch seiner Stimme
ordnen sich die Dinge der Welt neu. Sie bleiben,
was sie sind, und zeigen sich doch ganz
anders. Denn berufen ist man nicht getrennt
von der Welt, sondern in der Welt, in der
Schöpfung, die es nur gibt, weil Gott sie –
alles, was ist – gerufen hat: ins Sein hinein
und damit in eine Güte hinein, die von ihm
her kommt. Gegen die Welt kann man nicht
berufen sein. Berufen ist man allerdings
nicht einfach nur in der Welt, sondern immer
für die Welt, an einem konkreten Ort:
»Hier!« Daher lässt sich keine weltlose Berufung
denken, keine Berufung, die von der
Welt wegführt. Auch die Berufung zu einem
kirchlichen Dienst ist keine Berufung in
die Weltferne. Berufung führt immer in die
Welt – mit allen Risiken, die mit dieser Welthaftigkeit verbunden sind. Es ist eine Berufung
dazu, in der Welt Gutes zu tun, eine
Berufung zum Einsatz für Gerechtigkeit,
Güte und Liebe. Das bedeutet nicht, dass die
Berufung immer mit einem sichtbaren politischen
oder sozialen Engagement verbunden
sein muss. Sie kann in die Einsamkeit
führen, in der man nichts anderes für die
Welt tut, als für sie zu beten. Aber welche
Kraft liegt in einem solchen Gebet aus berufenem
Munde? Wie dankbar dürfen wir sein,
dass manche berufene Menschen nicht nur
hier und dort die Welt zu verbessern suchen,
sondern dass andere berufene Menschen in
Abgeschiedenheit und Stille für die Welt beten?
Stil(l)e der Berufungen
In jeder wirklichen Berufung äußert sich
Gott selbst, so zerbrechlich, so erschütterbar
die Gewissheit auch sein mag, dass Gott
es ist, der beruft. Er tritt nach außen hin,
macht einen Schritt auf den Menschen zu
und veräußert das, was ihm am liebsten ist,
was er selbst ist: Liebe. Als Liebe ist er keine
ewige Substanz, sondern ein Geschehen,
ein Vollzug, ein Ereignis. Er ist in sich selbst
schon Kommunikation, Gemeinschaft, das
Wechselspiel von Anspruch und Antwort.
Wer »Berufung« christlich zu verstehen versucht,
kann daher nicht anders, als auch von
dem dreieinen Gott zu sprechen.
Das Johannesevangelium spricht davon,
dass im Anfang das Wort, der Logos, war,
und dass dieser Logos bei Gott war und Gott
war (Joh 1,1 ff.) In Gott selbst erklingt der
Ruf des Logos, des Wortes. Gott selbst ist die
Einheit von Rufer, Berufenem und Berufung.
Indem dieser rufend-berufene Gott in der
Schöpfung nach außen tritt, indem Gott sich
dem Menschen in der Offenbarung gegenüber
äußert, indem er selbst Mensch wird
und den Menschen von Mensch zu Mensch
anspricht und indem er den Anspruch und
die Verheißung der Erlösung an den Menschen
richtet, tritt Gott mit einem konkreten
Ruf an den Menschen. Menschensein bedeutet,
zum Heil berufen zu sein, immer schon,
immer wieder. Nichts anderes bedeutet die
theologische Lehre, dass sich die Natur in der Gnade vollende. Voller Sehnsucht warten wir Menschen auf den Ruf Gottes,
auf seine Berufung, die immer schon ergangen ist. Zwischen der Vergangenheit
des schöpferischen Rufes und der Zukunft eines heilen Ganzseins, im Jetzt des
»Hier!« sind wir – zur Berufung berufen.
Doch bleibt die Berufung, zu der wir berufen sind, oft aus. Wir hören nichts.
Gott antwortet uns nicht. Er schweigt. Wie kann das sein? Nicht selten stellen
wir uns unter Berufung etwas Spektakuläres vor. Oft werden Berufungen auch so
geschildert: mit Blitz und Donner, mit Tosen und Trompeten. Und manche Berufungen
sind genau so erfolgt. Wo sich allerdings ein derartiges »Spektakel« nicht
einstellt, scheint Gott nicht selten verstummt zu sein. Doch könnte es nicht sein,
dass Gott viel leiser ruft? Dass er gerade in der Stille seine Stimme erhebt? Das
wäre nicht überraschend bei einem Gott, der in der Ohnmacht seine Macht, im
Kleinen seine Größe zeigt. Wir sehnen uns nach seinem, nach einem göttlichen
Wort. Erklingt es vielleicht dort, wo wir zunächst nichts hören? Wo wir den Ruf
Gottes nicht erwarten? Wenn wir gar nicht mehr mit Gott rechnen? Wenn Gott
fern, schwach, tot zu sein scheint? Ruft er uns nicht an seinem eigenen Kreuz – und an den vielen Kreuzigungen, dem sinnlosen
Leiden und trostlosen Sterben so vieler
Menschen?
Wenn Gott sich aus Liebe und als Liebe
äußert, könnte es anders sein? Keinen Menschen
kann man zur Liebe zwingen. Und so
kann Gott uns auch nicht zur Liebe zwingen.
Aber er kann an uns vorbeigehen und
uns berühren. Er kann uns ansprechen, so
leise, dass wir es erst hören, wenn der Lärm
des Alltags verklungen ist. Er kann uns anziehen,
zu sich ziehen wie ein Mensch, der
uns gepackt hat und in den wir uns verliebt
haben. Und er kann – und wird – unendliche
Geduld mit uns haben. Denn er will, dass wir
selbst aus Liebe heraus ihm antworten. Wir
sollen uns selbst bestimmen, indem wir uns
auf ihn und seinen Ruf einstimmen. Das ist
die Logik der Berufung, in der ich zugleich
freies, stimmendes »Subjekt« und gepacktes,
gestimmtes »Objekt« bin. Zusammenspiel
von Aktivität und Passivität. Unentwirrbares
Ineinander von Freiheit und Bestimmung.
Das ist die Logik eines jeden wirklichen, im
Wechselspiel von Hören und Sprechen verlaufenden
Gespräches. Die Logik der Nähe,
die zwischen Identität und Differenz oszilliert.
Und die Logik echter Liebe, in der ich
erfahre, wer ich sein darf und, vor allem und
zunächst, dass ich sein darf.
Könnte die Krise der Berufungen – wenn
es denn heute wirklich eine solche Krise gibt
– nicht auch damit zusammenhängen, dass
wir die Stille nicht mehr aushalten? Dass
wir die mögliche Gottesnähe nicht aushalten?
Dass wir auch die Liebe, den Eros wie
auch die Caritas, die so mächtigen Spuren
der Liebe Gottes unter uns Menschen,
zu einem Konsumgegenstand und einem
Tauschgeschäft gemacht haben? Ja, dass
wir auch in der Kirche die Berufungen zu etwas
gemacht haben, das man managen und
verwalten kann?
Kunstwerke der Berufungen
Wozu bin ich berufen? Diese Frage fällt
schwer. Ob sie heute schwerer fällt als früher?
Wer könnte das sagen. Nicht erst heute
ist es schwierig, den Ruf Gottes zu vernehmen.
Nicht erst heute hören wir lieber den eigenen, menschlich, allzu menschlichen Ruf. Nicht
erst heute lassen wir uns gerne ablenken. Immer wieder
gab es – von biblischen Zeiten bis heute – das Hadern
mit der eigenen Berufung. Immer wieder lösten
sich Berufungen ins Nichts hinein auf. Immer wieder
gab es aber auch neue Erfahrungen von Berufung.
Gerade der geschichtlich orientierte Blick lässt
daher nicht verzweifeln. Die Berufungen der Zukunft
werden allerdings auch andere Berufungen sein als
jene, an die wir uns gewöhnt haben. Zu lange haben
wir vielleicht allzu feste, starre Vorstellungen davon
gehabt, was Berufung bedeutet. Aber ist ein Merkmal
der Berufung nicht ihre Lebendigkeit – weil sie auf
den Ruf des lebendigen Gottes verweist? Und ruft
Gott nicht jeden neu, anders, in überraschender Weise?
Berufung ist nicht die Mitteilung eines feststehenden
Planes, als sei Gott ein Unternehmer, der Arbeitsaufgaben
mitteilt. Sie ist auch kein technischer
Prozess, der, wenn er einmal angestoßen wurde, nach
festen Regeln abläuft, sondern eher so etwas wie ein
Kunstwerk, ein Stück, ein Spiel von Gott und Mensch,
das zur Aufführung auf der Weltbühne kommt und
das sich im Laufe der Zeit entfaltet und vertieft. Eine
Dynamik, die immer neue Räume eröffnet. So etwas
wie ein Tanz. Ein Hin und Her. Ein Führen und Geführt-
Werden. Ein Ziehen und Gezogen-Werden. Ein
Lassen und Sich-Einlassen. Interaktion. Beziehung.
So vielfältig die Gesichter der Menschen und ihre Beziehungen
zu Gott sind, so vielfältig sind auch die Gesichter
der Berufungen.
Zur Person
Holger Zaborowski
ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Kürzlich ist von ihm ein Gesprächsband mit Gesine
Schwan erschienen: »Warum ich die Hoffnung nicht aufgebe« (Patmos).