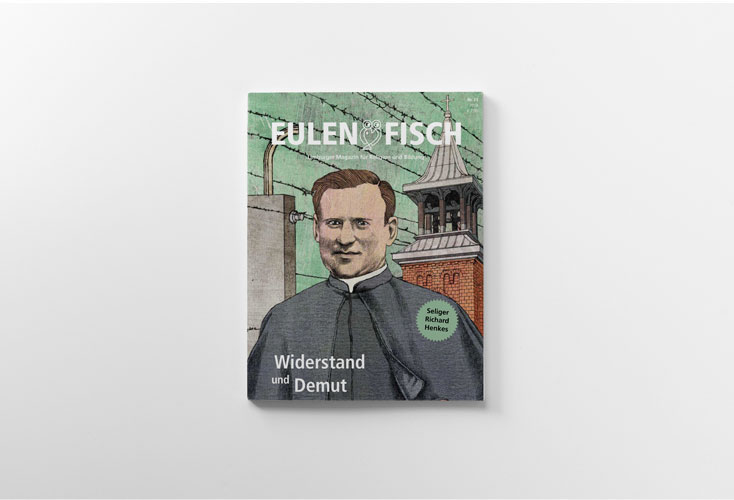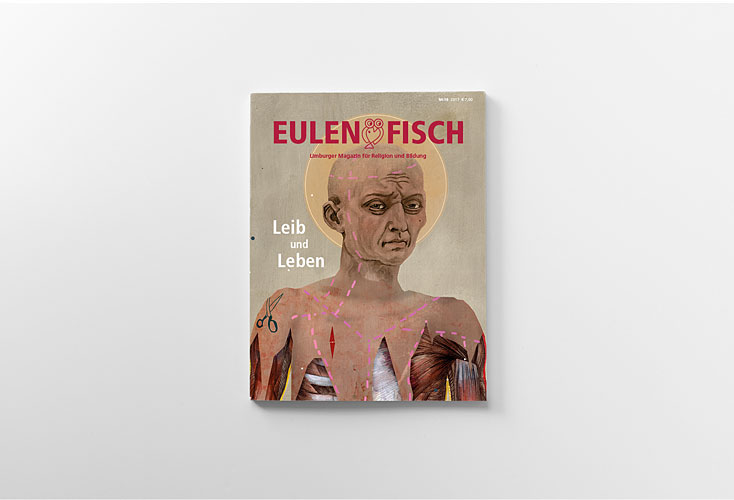Wohlwollen und Versöhnung
Vom Frieden sprechen – im Schatten des Krieges
Vor der »Zeitenwende«: Angesichts des Krieges leben
Der Zweite Weltkrieg verweist auf eine Schuld, mit der
wir – die Deutschen – uns auseinandersetzen müssen.
Auch heute, fast 80 Jahre nach seinem Ende, stellt
sich uns diese Aufgabe. Die Gegenwart steht – allen
populistischen Versuchen einer Uminterpretation der
deutschen Vergangenheit oder der gebotenen Erinnerung an sie zum Trotz – immer noch im Schatten des
Zweiten (und auch des Ersten) Weltkrieges. Das zeigt
sich in aktuellen Diskussionen über Waffenlieferungen an die Ukraine, über die Ausstattung, Finanzierung und Rolle der Bundeswehr und prinzipiell über
die Bedeutung Deutschlands in einer Welt, die sich
mit neuen politischen und militärischen Herausforderungen auseinanderzusetzen hat.
»Nie wieder Krieg!« – unter diesen Worten wuchsen die Nachkriegsgenerationen auf. Sie wurden groß
unter den Fotos von Verwandten, die sie nie kennen
lernen konnten, die jedoch in den Erzählungen der
Eltern oder Großeltern oder auch ohne dass von ihnen ausdrücklich erzählt wurde, eine unheimliche
Präsenz zeigten. Der noch so kindliche, unschuldige,
weltbegierige und doch so scheue Blick des jüngeren
PERSPEKTIVEN
Bruders der Großmutter, des Großonkels, der ein Unbekannter blieb, war wie ein stummes Zeugnis, ein
Ruf gegen das Vergessen, ein Auftrag für die Zukunft.
Es gibt Kriegskinder und Kriegsenkel, deren Leben,
auch wenn sie nachgeboren sind, auch wenn sie das,
was ihre Vorfahren erlebten, nicht selbst erfahren
mussten, noch von Kriegserfahrungen beeinflusst ist.
»Nie wieder!« Erwachsen wurden diese Generationen
vor allem aber angesichts des Abgrundes kollektiver
Schuld, nicht allein am Krieg, sondern auch an der
Shoah, an der Vernichtung unzähliger Menschen, einer Schuld, für die es bis heute keine angemessenen
Worte gibt, die sich ein, zwei Generationen nach den
historischen Ereignissen nicht abwälzen lässt und
die sich – so viel wissen wir heute – nicht verdrängen
lässt und auch gar nicht verdrängt oder vergessen
werden darf. »Nie wieder!« Geschichte, die bleibende
Gegenwart ist, Mahnung und Aufgabe in einem. Geschichte, die der Erinnerung und des Gedenkens bedarf. Und der Hoffnung, dass Frieden möglich ist, ja,
dass man für den Frieden kämpfen muss.
Europa – als Projekt, als Vision, als Utopie – ist ein konkretes Zeichen einer solchen
Hoffnung. Man darf, auch wenn sich immer
wieder Probleme bei der europäischen Integration zeigen und vieles, alte Gewissheiten
und Überzeugungen, ins Wanken geraten ist,
die Leistungen Europas – nicht allein der
Europäischen Union – nicht kleinreden – gerade in Anbetracht der deutschen Schuld.
Versöhnung unter ehemaligen Feinden –
trotz aller bleibenden oder regelmäßig aufkommenden Spannungen. Wohlwollen, wo
alles einmal unter Verdacht gestellt werden
musste. Freundschaft, wo Hass regierte. Annäherungen, wo Distanz waltete. Verstehen,
wo Unverständnis herrschte. Versöhnung
trotz des Unverzeihlichen. Recht, wo die
Sprache der Gewalt ihre Befehle diktierte.
Wir – in Europa, in Deutschland, in der Mitte, im Herzen Europas – haben rückblickend
sehr viel Glück gehabt. Ja, es gab und gibt
eine europäische Nachkriegsordnung, für
die es dankbar zu sein gilt.
Doch darf man angesichts dessen, was erreicht wurde, in Anbetracht der friedlichen
Jahrzehnte seit 1945 in West- und Teilen
Mitteleuropas nicht zu idealistisch werden.
Es gab auch nach 1945 Kriege und kriegerische Gewalt in Europa und unter Beteiligung europäischer Länder außerhalb Europas. Und es gab mitten in Europa den Krieg,
der erkaltet war. Die Waffen standen still
und schwiegen – aber nur auf Zeit, unter
Vorbehalt, bis auf weiteres. In vielen Situationen – nicht nur während der Kuba-Krise – hätte der Kalte Krieg zu einem »heißen«
Krieg werden können. Auch wenn man abrüstete, so nie derart radikal, dass es keinen
Krieg mehr hätte geben können. Der Frieden
vor der Zeitenwende war zutiefst brüchig,
immer gefährdet, nur partiell, eher die Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen als ein wirklicher Frieden, der
mehr und anderes ist als das Schweigen von
Waffen – so wichtig dieses Schweigen ist, als
ein erster Schritt, als Fundament, auf dem
man ein Haus des Friedens bauen kann.
Nach der »Zeitenwende«: Über Frieden nachdenken
Nun befinden wir uns nach der »Zeitenwende«. Deutschland steht nicht im Krieg. Und
doch ist uns ein Krieg nahegerückt, von dem
man lange gedacht hat, dass es ihn – einen
solchen fast altertümlichen, aus der Zeit
gefallenen Krieg, eine solche Gewalt, eine solche Hinterhältigkeit – nicht mehr geben
würde. Dieser Krieg in unmittelbarer Nähe
betrifft uns – politisch, gesellschaftlich,
aber auch emotional. Doch zugleich ist uns –
Zeitenwende hin oder her – der Krieg immer
noch sehr fern. Was hat sich seitdem verändert? Ist an die Stelle des anfänglichen Entsetzens über den russischen Angriff auf die
Ukraine nicht mittlerweile Gewöhnung und
Gleichgültigkeit getreten? Lesen viele, die zu
Beginn des Krieges noch begierig jede Nachricht verfolgten, mittlerweile nicht nur noch
Überschriften? Hat sich, wer anfänglich auf
ein schnelles Kriegsende zu hoffen wagte,
nicht schon auf einen langen Kriegsverlauf
eingestellt? Ist der Krieg in vielgestaltigen
Krisenzeiten nicht zu einer neuen Normalsituation geworden? Weil man zwangsläufig
abstumpft? Weil uns die Menschen in der
Ukraine doch nicht so nahe sind, wie es zunächst erschienen ist? Weil es so viele andere
Krisen und Herausforderungen gibt, die wir
meistern müssen oder müssten, ohne recht
zu wissen, wie uns das gelingen kann? Weil
wir überhaupt so wenig tun können und unsere Kräfte beschränkt sind? Und doch ist er
Wirklichkeit – dieser Krieg in Europa. Und
wird es vermutlich noch länger sein, als uns
lieb ist – und als wir ihn von unserem Alltag
fernhalten und verdrängen können.
»Geschichte ist Mahnung und Aufgabe in einem«
Kriege hat es immer gegeben. Wäre es nicht vermessen zu hoffen, dass es sie nicht mehr geben werde? War der Pazifismus, den man sich in den letzten
Jahrzehnten erlaubt hatte, nicht eine fromme Illusion,
ein Wunsch, der realpolitisch immer wieder scheitern
musste? Vielleicht ist das – neben der Verdrängung
des Krieges – auch ein Grund dafür, dass es keine nennenswerte(n) Friedensbewegung(en) mehr gibt. Kaum
Demonstrationen für den Frieden. Ohne Frage: Für
den Frieden zu demonstrieren fällt in der gegenwärtigen Situation schwer. Früher hat für den Frieden
demonstriert, wer gegen einen Krieg war. Das eine
bedingte das andere. Frieden schaffen ohne Waffen.
Die Lager konnte man deutlich unterscheiden. Heute
haben sich die Verhältnisse verschoben. Man kann –
und sollte – immer noch gegen Kriege und für Frieden sein. Aber viele, die eigentlich immer für Frieden
eingetreten sind, fordern heute die Fortsetzung des
Kriegs – und das heißt: die militärische Unterstützung
der Ukraine – und müssen sie um des langfristigen
Friedens willen fordern. Daher reden laut vom Frieden nicht selten nur noch jene, die die Wirklichkeit
des Krieges nicht ernst zu nehmen scheinen. Die meinen, man müsse nur mit Putin noch einmal sprechen,
um den Krieg zu beenden. Die glauben, die Ukraine
müsse endlich Zugeständnisse machen und sich dem
Willen des russischen Imperators beugen. Oder die
gar denken, der wahre Kriegsgrund liege im Westen.
Wladimir Putin hat jedoch Tatsachen gesetzt, auf die
sich nicht nur mit Friedensrufen antworten lässt. Das
wäre ungerecht. Es befreit die Ukraine nicht von ihrem gewalttätigen Aggressor. Und es verhindert nicht
die Gefahr, dass auch andere Länder von Russland
überfallen werden. Die Ukraine muss sich verteidigen
und hat jedes Recht dazu. Der Krieg erscheint um des
Friedens willen unausweichlich.
Und wir – in Deutschland, in der Europäischen Union? Wir helfen von außen, vom Rande her, so gut wir
können, ohne dass wir uns direkt in das Kriegsgeschehen einbeziehen lassen wollen. Kriegspartei sind wir
nicht. Dürfen wir nicht sein. Drohend steht die Gefahr
eines Dritten Weltkriegs oder eines Einsatzes nuklearer Waffen am Horizont. Politik ist zu einer schmalen Gratwanderung geworden. Ein einziger Schritt in
die falsche Richtung, ein falsches Wort, eine missverständliche Handlung könnte ins Verderben führen. Allerorten lauert der Abgrund. Wir müssen daher wieder
über den Krieg nachdenken: über den gerechten Krieg
und seine Kriterien. Dazu führt nicht allein die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine, sondern auch die Gefahr anderer Kriege – von den neuen
Möglichkeiten digitaler Kriegsführung ganz
zu schweigen. Doch ist es nicht gerade dieser Abgrund, der auch dazu führen müsste,
neu über Frieden nachzudenken und für ihn
zu demonstrieren? Dürfen wir vom und über
den Frieden schweigen? Wissen wir noch,
was das sein könnte: ein Frieden, der mehr
ist als die Abwesenheit von Krieg? Kann man
den Frieden jenen überlassen, die naiv oder
blind sind, die Verschwörungstheorien anhängen, Opfer mit Tätern verwechseln oder
komplexe Gemengelagen auf simplifizierte
Schwarz-Weiß-Bilder reduzieren? Ist vom
Frieden zu sprechen nicht eine Aufgabe, die
sich allen stellt – umso mehr, je länger der
Krieg andauert und je mehr Opfer er fordert?
Müssten wir nicht gerade trotz der Unausweichlichkeit der Kriegssituation für den
Frieden demonstrieren – allein um dem Auftrag der Geschichte treu zu bleiben? Zeugnis ablegen für eine Vision eines Zusammenlebens ohne Gewalt? Wäre es nicht jetzt
schon an der Zeit – auch mit Blick auf das,
was derzeit in Israel geschieht, auf andere
schwelende Konflikte und Gefahrenherde im
Nahen und im Fernen Osten und anderswo
auf der Welt – sich für den Frieden stark zu
machen und über das, was Frieden ist und
wo man ihn erreichen kann, nachzudenken?
Immanuel Kant: Der »ewige Friede« als Aufgabe
Dem Philosophen Immanuel Kant stand klar
vor Augen, dass der »Friedenszustand unter
Menschen, die nebeneinander leben, (…) kein
Naturzustand« ist. Umso wichtiger schien
auch ihm, über den Frieden nachzudenken
– in seiner bis heute wichtigen, gerade jetzt
aktuellen Schrift »Zum ewigen Frieden«. In
diesem Text dachte er politisch-philosophisch und völkerrechtlich über die Bedingungen eines »ewigen Friedens« – über das
Schweigen der Waffen hinaus – nach. Dabei
war er nicht nur für seine Zeit radikal. So
fordert er in den »Präliminarartikeln zum
ewigen Frieden«, dass Friedensschlüsse
nicht unter Bedingungen geschlossen werden dürfen, die zu einem neuen Krieg führen, dass kein souveräner Staat von einem anderen Staat erworben werden darf, dass stehende
Heere abgeschafft werden sollen, dass die Staaten
keine Schulden für den auswärtigen Staatshandel
machen dürfen, dass kein Staat sich gewaltsam in die
Verfassung und Regierung eines anderen Staates einmischen darf und dass kein Staat einen Krieg gegen
einen anderen Staat so führen darf, dass danach kein
Frieden mehr möglich ist. Dies sind bis heute wichtige
Forderungen: Auch Staaten stehen in ihrem Verhältnis
zueinander nicht in einem rechts- oder moralfreien
Raum, sondern müssen sich in einer gewissen Weise
zueinander verhalten. Sie müssen die Souveränität
des anderen Staates achten, und selbst wenn es zu
einem Krieg kommt, diesen in einer Weise führen, der
auf einen möglichen – echten – Frieden hin orientiert
ist. Man kann sehr genau zeigen, gegen welche Artikel
der gegenwärtige Krieg Russlands gegen die Ukraine
verstößt – und dadurch die Bedeutung dieser Überlegungen zu den elementaren Bedingungen des Friedens zeigen.
Kant vertieft die Präliminarartikel durch Definitivartikel, die auf langfristige politische Veränderungen hinzielen. In diesen legt er u. a. fest, dass die
bürgerliche Verfassung in jedem Staat republikanisch
sein soll, dass das Völkerrecht »auf einen freien Föderalismus freier Staaten gegründet sein« soll oder
dass das »Weltbürgerrecht (…) auf Bedingungen der
allgemeinen Hospitabilität eingeschränkt werden
soll«, dass also ein fremder Mensch kein Gast-, sondern ein Besuchsrecht in anderen Ländern habe. Kant
setzt sich für Menschenrechte, für ein Völkerrecht
und einen Völkerbund ein, die allesamt eine zentrale
Aufgabe für den Frieden haben. So nimmt er wichtige
Errungenschaften der späteren (Welt-)Politik vorweg.
»Eine langfristige Friedenspolitik müsste bei einer Politik der Gefühle ansetzen«
Kant weiß um die moralischen Grenzen des Menschen und seine Neigung zum Bösen. Allerdings gibt
es seiner Ansicht nach nicht nur die Möglichkeiten
der Vernunft, die Schritte zum ewigen Frieden formulieren kann, sondern auch eine List der Natur. Diese
führe dazu, dass die Menschheit, auch wenn sie dies nicht ausdrücklich wolle, sich dem Frieden immer
weiter annähere. Die Gründe dafür findet er in zunehmend engen Wirtschaftsbeziehungen – Kant bezieht
sich hier auf den »Handelsgeist, der mit dem Kriege
nicht zusammen bestehen kann, und der früher oder
später sich jedes Volks bemächtigt« – oder schlicht in
den Kosten und den mangelnden Erfolgen von Kriegen. Er spricht von der »großen Künstlerin Natur (…),
aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der
Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen zu lassen (…).« Dieser erste »Zusatz« zeigt
deutlich Kants aufgeklärte Geschichtsphilosophie,
dass, wenn auch der Mensch immer wieder an seinen hehren Idealen scheitere, die »Natur, durch den
Mechanismus in den menschlichen Neigungen selbst,
den ewigen Frieden« garantiere.
Diese hoffnungsvolle Sicht zeigt sich auch daran,
dass Kant in einem zweiten »Zusatz« einen »geheimen
Artikel zum ewigen Frieden« formuliert. Dieser lautet:
»Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen
der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von
den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rate
gezogen werden.« Kant weiß um die faktischen, bis heute erlebbaren Spannungen
zwischen Moral und Politik, geht aber theoretisch davon aus, dass beide – das Denken der Philosophen und das Handeln der
Politiker – im transzendentalen, also nicht
empirisch vorgefundenen, sondern mit der Vernunft
erschlossenen Begriff des »öffentlichen Rechts« miteinander übereinstimmen. Er schließt daher seine Schrift ausdrücklich voller Hoffnung: »Wenn es
Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist,
den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur
in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung
wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf
die bisher fälschlich so genannten Friedensschlüsse
(eigentlich Waffenstillstände) folgt, keine leere Idee,
sondern eine Aufgabe, die, nach und nach aufgelöst,
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer kürzer werden)
beständig näher kommt.«
Kant veröffentlichte diesen Text 1795. Im Untertitel
nannte er ihn einen »philosophischen Entwurf«. Das
zeigt, dass Kant sich selbst des vorläufigen und skizzenhaften Charakters seiner Überlegungen bewusst
gewesen ist. Rückblickend zeigt sich ein ambivalentes Bild. Manche Kriege mögen aufgrund von Kants
Überlegungen verhindert worden sein. Man darf die Bedeutung seiner Überlegungen, die Staatenbünde wie die Europäische Union oder
die Vereinten Nationen vorwegnehmen,
nicht unterschätzen. Doch zugleich ist der
Krieg Realität geblieben. Allerdings stellt
das nicht die Überlegungen von Kant in Frage. Vielleicht hat er gar nicht mit einem sehr
schnellen Fortschritt in Richtung Frieden
gerechnet. Und wo wären wir ohne die Hoffnung, die er artikuliert? Muss man nicht
gerade an seiner denkerischen Perspektive
festhalten, um im Alltäglichen kleine Schritte zum Frieden hin gehen zu können? Man
darf, so zeigt Kant, nicht an der Möglichkeit eines »ewigen Friedens« – und an der
Möglichkeit der Vernunft und der »List der
Natur« – verzweifeln. Man muss darüber
nachdenken, welche Bedingungen erfüllt
sein müssen, damit Frieden herrscht. Das
ist heute – angesichts der Möglichkeiten
atomarer, biologischer, chemischer oder digitaler Kriegsführung – schwieriger als am
Ende des 18. Jahrhunderts. Aber das bedeutet nicht, dass man auf diese Aufgabe der
Vernunft verzichten darf.
Vernunft und Emotion: Wohlwollen und Versöhnung als Schritte zum Frieden
Die Vernunft wird auch heute noch hochgeschätzt. Wie oft konnte man vor dem Februar 2022 lesen, dass Putin vernünftig sei und
deshalb keinen Krieg beginnen werde? Wie
oft kann man das heute lesen – mit Blick
auf andere Potentaten und Autokraten? Wie
häufig finden sich gute vernünftige Argumente für den Frieden oder für die Schritte zum Frieden? Wie oft erklingt der Ruf
nach Nüchternheit und Rationalität, nach
der Geltung des Rechts und der vernünftigen Ordnung der Verhältnisse von Staaten
zueinander? Und wie wahr und wichtig ist
dieser Ruf. Das zeigen ja nicht zuletzt Kants
Überlegungen zum ewigen Frieden. Doch
wusste Kant auch, dass die Politik im wirklichen Leben nicht nur vernünftig ist – und
zwar weil der Mensch nicht nur vernünftig
handelt. Das ist eine triviale, aber oft übersehene Wahrheit. Menschen sind auch emotionale, von Gefühlen bestimmte Wesen. Genau diese Emotionalität wurde und wird oft
übersehen, so als ließe sich Politik nach den
Regeln eines philosophischen oder politikwissenschaftlichen Oberseminars gestalten:
rational, diskursiv, dem besseren Argument
verpflichtet. Oder als sei das Emotionale etwas Dunkles oder gar Ungehöriges, das es in
die Sprache der Vernunft zu übersetzen oder
gar zu verdrängen gilt. Doch kommt das
Verdrängte zurück – nicht selten mit einer
Kraft, die dann kaum noch zu beherrschen
ist. Dagegen kann auch die »List der Natur«
wenig ausrichten.
Wenn in der Gegenwart die Politik oft
im Zeichen von Angst, Wut oder Ressentiment erscheint, dann hat das genau damit
zu tun, dass man lange die emotionalen Voraussetzungen, Begleitumstände und Folgen bestimmter Entscheidungen und Handlungen nicht beachtet hat. Angst, Wut und
Ressentiment haben sich weder auf der internationalen noch auf der nationalen Ebene nicht zufällig entwickelt. Sie gehen auf
Kränkungen, auf mangelnde Wertschätzung
oder auf tief reichende Verletzungen zurück.
Eine Philosophie und Politik des Friedens
darf diese emotionalen Ebenen nicht übersehen. Vor allem darf die Politik die Gründe für sie nicht noch verschärfen. Man kann
Kants These, keine Kriegsführung dürfe so
gestaltet sein, dass ein anschließender Friede unmöglich werde, in diese Richtung lesen. Doch man müsste dabei die Politik in
Friedenszeiten einbeziehen: Auch diese darf
nicht ein Gegenüber derart kränken oder
verletzen, dass es irgendwann zu einer Entladung von Hass und Aggression kommen
wird, die nicht mehr mit friedlichen Mitteln
beherrschbar ist.
Eine langfristige Friedenspolitik müsste
daher auch bei einer Politik der Gefühle ansetzen. Sie setzt an – das gilt für Konflikte
innerhalb einer Gesellschaft wie auch zwischen Staaten – bei der Anerkennung und
der Wertschätzung des Gegenübers – nicht
primär als radikaler Feind, sondern als
Gruppe von Mitmenschen mit einer unverletzlichen Würde, mit unveräußerlichen
Rechten und mit Interessen, die den eigenen Anliegen ähnlich sind. Das bedeutet nicht, blind für Ambivalenzen oder problematische Aspekte im Verhalten der anderen
zu sein. Es gibt Differenzen, Eigenarten und
Verhaltensweisen anderer Menschen oder
Nationen, denen man nicht mit Indifferenz
begegnen darf. Man muss sie benennen –
auch auf die Gefahr hin, dass das Gegenüber nicht hören möchte, was man sagt, und
dass man zu Gegnern in einem Konflikt wird
und auf die Gefahr hin, dass man selbst kritisch in Frage gestellt werden kann. Jede
wirkliche Begegnung setzt die Bereitschaft
zur Selbstkritik und zur Korrektur voraus.
Grundlegend ist mit Blick auf den Frieden
der Primat einer Hermeneutik des Wohlwollens statt einer Hermeneutik des Verdachts.
Ein Verdacht dem anderen gegenüber und
ein entsprechend vorsichtiges Verhalten
kann angebracht sein. Nicht selten ist diese Vorsicht sogar notwendig. Aber sie darf
nicht zur Regel werden. Denn nur im Rahmen einer Hermeneutik des Wohlwollens
ist Versöhnung möglich, eine versöhnte Verschiedenheit. Und ist dies nicht ein anderes
Wort für »Frieden«?
Dieser Frieden bleibt eine Aufgabe – gerade nach der »Zeitenwende«. Kant schreibt
diese Aufgabe weitestgehend den Politikern
und den Philosophen zu. Doch bedarf der
Frieden einer bestimmten Kultur. Diese entsteht nicht von oben, sondern von unten. Sie
unterstützt das harte Geschäft der Politik.
Dabei können die Künste und die Religionen
eine besondere Rolle spielen. In den Künsten – das zeigen die beeindruckenden, die
Brutalität des Krieges nicht verleugnenden,
aber auch an die Möglichkeit und Notwendigkeit des Friedens erinnernden Arbeiten
von Volker Schlecht und Alexandra Kardinar in diesem Heft – mag eine Möglichkeit
der Gerechtigkeit und Versöhnung, ein Bild
friedlichen Lebens auftauchen, das nicht die
Wirklichkeit einfach nur abbildet, sondern
in sie eingreift und sie verändert. Und in
den Religionen kann sich ein – freilich oft
verkanntes, freilich oft von religiösen Menschen selbst verratenes – friedensstiftendes
Potential zeigen. Gerade die biblischen Texte
handeln von Frieden: von einem Frieden,
den die Welt nicht gibt, der sich aber in Gott oder von Gott her findet, aber auch von einem Frieden,
um den Menschen sich bemühen können und müssen:
jeden Tag neu, jeden Tag zunächst bei sich selbst, jeden Tag in Gesellschaft, Politik und in der Welt. Vielleicht muss man aus dieser Perspektive gerade heute
wieder rufen »Nie wieder!« – nicht, weil man naiv die
gegenwärtige Situation verkennen, verdrängen oder
verzerren würde, sondern weil man alles, was heute
geschehen muss, in einen weiteren, umfassenderen,
menschlicheren Horizont zu stellen wagt, in den Horizont eines Friedens, der dauerhaft oder sogar ewig
sein könnte. Welche Hoffnung hätten wir noch – heute, nach der Zeitenwende – ohne ein solches Ideal?
Und müssten wir nicht mehr und engagierter noch
von diesem Ideal Zeugnis ablegen?